Wünsch dir was!
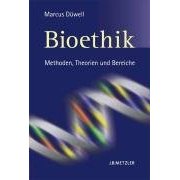
Manche Theorien sind ganz einfach zu begreifen, und sie stimmen auch noch. Zum Beispiel die „broken-windows“-Theorie. Ihr zufolge laden etwa Autos mit einem oder mehr zerbrochenen Fensterscheiben mehr dazu ein, eben diese auszuweiden, als nicht zerstörte. Man lernt daraus: Wehret den Anfängen. Diese Theorie folgt dem sogenannten „slippery slope“-Argument, nach dem der erste Verteidigungsring der wichtigste ist: Übertragen auf das Gebiet der Bioethik würde das Argument hinsichtlich Sterbehilfe folgendermaßen lauten: „Wer einmal das Tor zur Freigabe der Sterbehilfe öffne, der gerate zwangsläufig auf eine Bahn, die es erst erlaube, schwer Kranke zu töten, dann Behinderte und schließlich das Lebensrecht eines jeden zur Debatte stelle.“ (Düwell 191 f.) Dieses Argument ist so bekannt, dass es erstaunt, wie wenige trojanische Pferde man dann doch zu Gesicht bekommt. Aber vielleicht überzeugt es auch einfach so gut.
Marcus Düwell hat mit seiner sehr lesbaren und empfehlenswerten Einführung in die Bioethik aber natürlich etwas ganz anderes vor, als uns zu bestimmten Haltungen zu bringen. Ihm geht es vor allem darum, das „Komplexitätsniveau“, das sich mittlerweile um das interdisziplinäre Fach Bioethik gebildet hat, nachzuzeichnen. Wenn hier diskutiert wird, dann ohne mit dem Rücken zur Wand zu stehen. Das vorliegende Buch zählt also nicht zur Ratgeberliteratur. Es führt vielmehr vor, dass es eine solche zum Thema Bioethik gar nicht geben kann – und zwar unabhängig davon, wie man zu Bioethik stehen mag. Diejenigen, die Bioethik als unwissenschaftlich verwerfen, erwarten auch nichts von ihr, schon gar keine bindenden Vorschriften. Diejenigen hingegen, die sich von der vermeintlichen Unwissenschaftlichkeit nicht beirren lassen, werden sagen, man habe keine Zeit, auf das Wissenschaftlichwerden der Bioethik zu warten, weil die „Life Sciences“ eben jetzt schon da sind und auf Steuerung warten.
Marcus Düwell gehört zu denen, die Bioethik ernst nehmen. Er stellt Stärken und Schwächen von Methoden und Theorien vor, macht von vornherein klar, dass es sich bei den Statements der Bioethik um „gemischte Urteile“ handelt, die also keineswegs nur aus dem Gebiet der Ethik selbst stammen, sondern notwendigerweise Hightech-Kenntnisse, Evaluationen über mögliche technische Weiterentwicklungen und beispielsweise juristische Sachlagen miteinander koppeln. Je nach ethischer Fundamentaleinstellung werden bioethische Fragen anders beantwortet. Ein Utilitarist wird den Einzelnen stärker in die Pflicht nehmen etwa in Sachen Organentnahme nach dem Tod des Betreffenden als jemand, der die Autonomie der Persönlichkeit auf die Zeit nach dem Tod ausdehnt. Genau an solchen heiklen Stellen muss man sich natürlich fragen, wie zugänglich die Betroffenen (und das sind letztlich alle) ausgefeilten Argumenten sind, oder ob eben nicht doch eine einmal eingenommene Einstellung als „Haltungs“-Argument die Kunst der Argumentation auflaufen lässt. Nicht jeder hat die Zeit, sich die entsprechenden Theorien und interdisziplinären Kenntnisse schnell anzueignen. Und wer sagt dann aber, dass Einrichtungen wie Ethikkommissionen korrekte und aussagekräftige Stellvertreterveranstaltungen sind? Wer entscheidet letztlich und nach welcher Maßgabe? Sollte man gegen „Transhumanisten“ argumentativ gewappnet sein, oder stellen diese radikal zukunftsoffenen Leute in Sachen Teleologie der Menschheit nicht eher die gegenwartsadäquaten Positionen bereit?
Eine weitere interessante Frage diskutiert Düwell am Beispiel der sogenannten Wunschmedizin (Enhancement), nämlich inwiefern Medizin überhaupt verpflichtet ist, am Krankheitsgebriff festzuhalten und nicht viel mehr die den Menschen optimierenden Faktoren ins Spiel bringen sollte. Wenn der Berliner Arzt Jacques Joseph zu Beginn des 20. Jahrhunderts „Judennasen“ schönheitschirurgisch korrigierte, war er vermutlich nicht bloß mit dem Spleen einiger Weniger konfrontiert. Die Wunschmedizin also vielleicht ein Sonderfall der Beuys’schen „Sozialen Plastik“? Bioethik, das erfährt man beiläufig in einer Fußnote, ist eine US-amerikanische Erfindung aus den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts, die zunächst ganz stark von der Theologie geprägt war. Der Papst wird bioethisch natürlich anders entscheiden als radikale Liberale, die eher zu „Clublösungen“ tendieren dürften als dass sie bereit wären, vorgängige Würdedefinitionen blind zu übernehmen. Ob die Düwell’sche Komplexitätszufuhr in der Lage ist, Einstellungsgewohnheiten aufzubrechen und viele kleine subprofessionelle Ethik-Clubs zu initiieren, bleibt abzuwarten. Aber analog zu Beuys’ Satz, Demokratie mache Spaß, kann schon jetzt formuliert werden: Bioethik macht Spaß.
Dieter Wenk (12-08)
Marcus Düwell, Bioethik. Methoden, Theorien und Bereiche, Stuttgart/Weimar 2008 (Metzler)