Stille im Welthaus
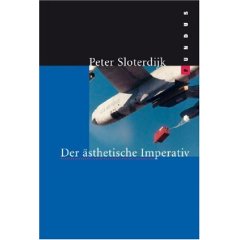
Im Nachwort des Künstlers Peter Weibel findet sich ein Hinweis, wie der Titel von Peter Sloterdijks Sammelband »Der ästhetische Imperativ« zu verstehen sei: Gegen Produktions- und Rezeptionsgebote, gegen die Zumutung einer Politisierung von Ästhetik und die reziproke Verführung zur Ästhetisierung von Politik schreibe Sloterdijk beständig an.
Das mag ja stimmen. Aber dass die Werke der Kunst keine moralische Gängelung erlauben, ist selbst schon eine ethisch korrekte Selbstverständlichkeit. Reicht Weibel nicht ein allzu niedrigschwelliges Angebot dafür nach, von welchen Forderungen Sloterdijks ästhetischer Imperativ handeln könnte? Müsste es nicht gegen den »Imperativ der Ethik« gehen, wenn das so einfach klar ginge? Zudem ebnet die sich wiederholende Anleihe bei Kant sicher auch den Weg zu einer anderen Lesart.
Diese »Schriften zur Kunst« weisen auch in die andere Richtung, aus der die Werke ihr Gegenüber zu etwas auffordern, wenngleich Sloterdijk dieses Etwas nicht allzu entschieden ans Licht bittet.
Man darf wohl terminologisch nicht zu pingelig sein. Immerhin kann Ästhetik hier durchaus als prima philosophia verstanden werden. Auf rund 500 Seiten sind Aufsätze in Kapiteln wie »Kunstsystem«, »Im Licht«, »Stadt und Architektur« oder »Museum« versammelt. Einige sind 15 oder 20 Jahre alt. Deshalb empfiehlt es sich, bei der Lektüre hin und wieder einen Blick ins Quellenverzeichnis zu werfen.
Manchmal wirken die neueren Arbeiten durchdachter und frischer als die alten. Manchmal ist es auch umgekehrt. Interessanterweise beginnt die Sammlung mit dem jüngsten und endet mit dem ältesten Text. Interessanterweise auch bringt dieser letzte Text, zuerst erschienen 1985 in einer Schrift namens »Ende der Kunst – Zukunft der Kunst«, ein Moment der Dringlichkeit mit, das späteren Texten oft fehlt: Sloterdijk brennen hier ein paar wichige Fragen auf den Nägeln. Und als wollte er uns genau jene Krümmung der Welt vor Augen führen, die er 450 Seiten zuvor als die besondere Bewegung kennzeichnet, die die Musik beschreibt, wirkt diese frühe Schrift, auf die alles zuläuft, wie eine intellektuelle Kraft-Wärme-Kopplung aller späteren Überlegungen mit dem Ursprung seiner Ideen.
Am Anfang stehen drei Texte unter dem Oberbegriff »Klangwelten«. Die Musik ist eine Kunst, die sich im Raum entfaltet und die Zeit gestaltet. Krümmung der Welt --– reden wir über Zeit oder über Raum? »Objektiv gesehen«, schreibt der Musikwissenschaftler Vladimir Karbusicky, »sollten diese Parameter in der Musik gleich bedeutend sein.« Tatsächlich überwiegen aber Raumvorstellungen. »Das Vokabular der Musiktheorie und theoretischer Musikdeutungen erweist die Priorität der räumlichen Begriffe: hoch – niedrig; oben – unten; klanglicher Hintergrund; Vordersatz – Nachsatz; crescendeo – diminuendo (... übertragen auf die Klangmasse, die den Raum füllt).«
Auch bei Sloterdijk überwiegt zunächst eine Raummetaphorik. In der Musik vollzieht sich demnach ein komplettes alternatives Weltverhältnis, das die Dualität von Subjekt und Objekt, Ich und Welt aufhebt. Es ist ein Gegenentwurf zum Cartesischen Erkenntnismodell, das die Selbstversicherung des Neuzeitsubjekts durch die Abwicklung der empirischen Wahrnehmung betreibt. Dieser Reduktion fällt auch der Hörsinn zum Opfer, eine entwicklungsgeschichtlich elementare Schnittstelle, eng mit dem Tastsinn verwandt, aktiv schon im Mutterleib.
Das Hören ist »kein Effekt des Gegenüberstehens eines Subjekts in Bezug auf eine Geräuschquelle … Das gilt in noch ausgeprägterer Weise für das Hören der Ungeborenen.« Sloterdijk geht es ums Eintauchen in die Offenheit des akustischen Feldes. Immersion heißt das Zauberwort des unreduzierten In-der-Welt-Seins. »Immersion überhaupt ist das Thema einer gewagteren Aufklärung.«
Der Schlüssel zur Musik ist das pränatale Aufgehobensein in Klang: in der Stimme der Mutter einerseits, im Pulsschlag und dem gedämpften Soundscape der Außenwelt andererseits. Wo dieses zwangsläufig mit der Geburt verstummt, weicht es einer ängstigenden existentiellen Stille. Die Angst bei Heidegger, so Sloterdijk, könne nichts anderes sein als Angst vor der furchtbaren Stille der Welt. Deshalb sei Heidegger überzeugt gewesen, unter der betriebsamen Geräuschkulisse des Dahinlebens schlafe die alte Panik.
Warum Sloterdijk seine entwicklungspsychologische Beobachtung und ihre existenzphilosophische Auslegung zu einem »tiefenmusikologischen« Grundsatz ausgräbt, bleibt allerdings sein Geheimnis. Indem er behauptet, »alles, was später gemachte Musik sein wird, kommt her von einer auferstandenen und wiedergefundenen Musik, die vom Kontinuum auch nach seiner Zerstörung zeugt«, stellt er die Originalität seiner Entdeckung in Frage. Auch in einem jüngeren Aufsatz (2006) greift er das Motiv im gleichen Sinn wieder auf. »Alle Musik, die elementare oder primitive zumal, geschieht zunächst ganz im Zeichen des Wiederfindens, auch in dem der Wiederholungsobsession – und bis hinauf zu ihren höchsten Gebilden ist die spezifische Faszination der Tonkunst … an den Effekt gebunden, dass eine vergessen geglaubte sonore Präsenz sich wieder einstellt.«
Der Allquantor muss Widerspruch auf sich ziehen. Will Sloterdijk sagen, alle tatsächlich erklingende Musik sei genau genommen Wiedererinnerung verlorener pränataler Geräuschkulissen? Möchte er bloß andeuten, dass der anthropologische Impuls zur Musik der Sehnsucht nach einer ursprünglichen Aufgehobenheit entspringt? Wie lässt sich der Innovationsdrang innerhalb der Tonkunst mit der Idee vereinbaren, alle Musik sei im Grunde »musique retrouvée«?
Sloterdijk kompensiert das, indem er der diagnostizierten Rückwendung einen Entdeckergestus gegenüberstellt. Dieser nimmt seinen Ausgang parallel zu und synchron mit der Expansionsbewegung der Europäer über die Ozeane zu neuen Kontinenten. Mit dem Aufbruch kommt die Kugelgestalt der Erde in den Blick. Die traditionellen Wissenssysteme wanken. In diese erste »Globalisierung« ist auch die Musik verwoben und bringt die Krümmung auf die ihr besondere Weise zur Darstellung: indem sie die gekrümmte Zeitlichkeit der menschlichen Existenz artikuliert.
Raum oder Zeit, der gekrümmten Bewegung ist das vielleicht einerlei. Doch selbst wenn man von der Rochade absieht: Lässt sich der Gedankengang – einmal ausgelöst aus Sloterdijks integralem Sprachbau – nachvollziehen? Und wie lässt sich der musikalische Expansionsmodus (»progressive Exodusmusik«) mit der Rückzugsdynamik in Einklang bringen, die schließlich aller Musik innewohnen soll? Gerne folgt man Sloterdijk zu der Vorstellung, dass die Entwicklung der modernen Musik einer Schatzsuche gleiche wie die Reisen der Entdecker. Am Ende findet er uns aber mit Glasperlen ab. Seine denkwürdige Konklusion lautet: »Was aber die Künstler dort finden, müssen sie selber erst erzeugen. Was sie wiederfinden, war niemals vor dem Fund gegeben.«
Es gibt sicher noch andere Denkwürdigkeiten. Die existenzphilosophische Erdung der Musik im Feld von Heideggers Angstbegriff liefert einen Eskapismusverdacht gegen jede Musik mit. Sloterdijk schließt zwar, Musik, die mehr als Narkose sei, feiere das Wiederanknüpfen ans Kontinuum (gemeint ist das pränatale) und erinnere an die kosmische Stille unserer Existenz. Doch der eigentliche Daseinsmodus müsste demnach eine unheimliche Stille sein.
Und was folgt aus dem forcierten Einsatz der Wiedererinnerung? Hat diese auch ethische Implikationen? Sloterdijks Gedanke ist, dass das Hören eine Bewegung zurück, aus der Welt, hinter die Individuation, ein Vollzug von Er-Innerung sei. Dieser quasi archäologische Tatendrang gefährdet das Projekt aber selbst: Nicht in der Tiefe wollte er die Musik ja aufsuchen, sondern in der Offenheit des Raums und der Zeit.
Und dann gibt es auch noch eine Portion Verfallssentiment mit der Behauptung, die synthetische Energie der europäischen Hochmusik scheine im zeitgenössischen Musikbetrieb verlorengegangen zu sein. Zwar wolle er nicht »die gute alte Zeit einer integralen Musik« beschwören. Aber der Tenor ist davon unbenommen: Musik ist heute ausdifferenziert und somit »zerfallen«.
Sloterdijks Fülle von originellen Gedanken, sein hier und da aufblitzendes intellektuelles Temperament und sokratische Beharrlichkeit wiegen viele gekrümmte Argumentationsstränge auf. Manchmal, falls man das so sagen kann, scheint der Philosoph wie Joe Cocker mit den Armen rudernd am Bühnenrand zu stehen, in sein tiefschürfendes Lied versunken. Und übrigens gibt es auch jede Menge Beipiele dafür, mit welchem Imperativ nach Sloterdijk Kunst und Künstler antreten, um das halbgare Bestehende zu konterkarieren. »Als Tiefeneinwohner der Welt erinnern [… die Künstler] an die Frage, wie das Welthaus überhaupt zu bewohnen sei.«
Ralf Schulte
Peter Sloterdijk: Der ästhetische Imperativ. Schriften zur Kunst
Herausgegeben von Peter Weibel
Philo & Philo Fine Arts/Europäische Verlagsanstalt
Hamburg 2007, 522 Seiten, 25 Euro