Auslandsdeutsch in Afrika
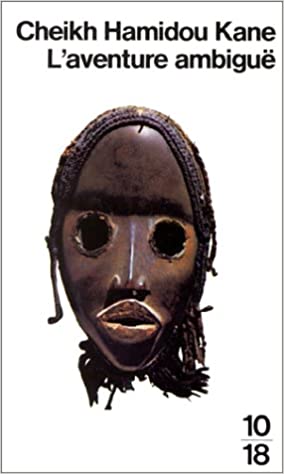
Doppeltblicken, Entwicklung, Bildung und ein Vorschlag
(Kapstädter Impulse)
Bruno Arich-Gerz
Der Weg bis hier verlief über das unterschiedlich ausgeprägte Gastgeben von Deutsch und afrikanische Sprachen zu den latent immer noch vorhabenden und neokolonial gefärbten Unterschieden beim Vermitteln von Deutsch als Fremdsprache an subsahara-afrikanischen Hochschulen. Ein Auflehnen gegen dieses Verständnis von Sprachvermittlung an im Deutschen nicht von Geburt an Hausende kam aus Westafrika und Hannover.
Die École d’Hanovre gründete sich in den 1980er Jahren, eine Reihe von Germanisten hatte sie hervorgebracht und akademisch durchqualifiziert; neben Alioune Sow und Norbert Ndong gehört unbedingt noch David Simo aus Kamerun genannt. Bereits bei Ndong lief das emanzipatorische Vorhaben heiß, das aus einer Programmatik Praxis werden lassen wollte. Er steckte in dreierlei Klemmen und war zudem gefangen im Paradoxon, an westafrikanischen Unis (auf) Deutsch propagieren zu müssen, um mit diesem Fremden einen auch laufbahnmäßig eigenen Weg zu gehen, und verlegte sich darauf, seine Germanistik nicht politisieren zu wollen – wie Sow es tut –, sondern ihre Literatur auszurufen als Hort potenziell widerständigen ‚Entwicklungswissens‘.
Nach Ndong und weiteren Hannoverschen Schülern der ersten Generation tradierte sich das Anliegen, weil Schüler immer auch eigene Schüler und Schülerinnen hervorbringen. Es erlahmte aber merklich und tritt heute splittergruppenartig oder, was schlimmer ist, verhausschweint auf als Teil eines nach wie vor dubiosen Dienstleistungsbetriebs – wie Sow es nannte –, der in Afrika wie weltweit mal als Auslands- und immer bundesdeutsch angeschobene Interkulturelle Germanistik verkauft wird.
In diesem Heute fand die Sommerschule in Kapstadt statt, bei der Kinder und Kindeskinder der ersten Generation zugegen waren. Eine Reihe von Impulsen ging von ihnen aus; nicht immer waren diese von erkennbar westafrikanisch-hannoverscher Prägung der 1980er Jahre. Beispielsweise gingen Kanonlektüre und capacity building ein unheimliches Bündnis ein bei einem, der Höhenkammliteratur (Goethe, Schiller, Fontane, Thomas Mann, Rilke und zur Not noch Grass) betrachtete als ideale Übung zur persönlichen wie universitären Selbstoptimierung in und mit Deutsch. Der es also nicht (mal) mehr als Vehikel von Entwicklungswissen sah wie der ihm akademisch-genealogisch väterliche Norbert Ndong: ein Wissen, das daherkommt als fingiert mit souveränem Anspruch und fiction, die der Lebenswirklichkeit mit ihren dubiosen Entwicklungsnachholbedarfen und Versprechen von Kapazitätssteigerung ihr Ding entgegensetzt.
Hinzu kommt eine vierte Klemme, in der die École d’Hanovre als überbietungsausgerichtete Impulsfabrik (Ndong musste sich auf Teufel komm raus absetzen von Sow) in Zeitenwende-Zeiten (1989) durch ihre Historisierung heute steckt. Das was von ihr konzeptionell überlebt hat, nämlich die Methode des sogenannten regard croisé oder Doppeltblicken als „interkulturelle Zusammenführung von Texten deutschsprachiger und afrikanischer Literatur“, so ihr Schulrektor Leo Kreutzer, bei der Alioune Sows Untersuchung von ‚Stunde-Null‘-Konstellationen im besiegten Zweitweltkriegsdeutschland (Wolfgang Koeppen) und in frisch unabhängig gewordenen westafrikanischen Ländern (Ousmane Sembène) ebenso nebeneinander gelegt wurden zum namensgebenden einander Anblicken wie ‚Vaterimaginationen‘ bei Ndong (Chinua Achebe, Mongo Beti – Nossack, Ruth Rehmann, Meckel) oder ‚Hunger‘ in der Promotion der Zimbabwerin Yemurai Gwatirisa (Dambudzo Marechera – Wolfgang Borchert) – dieses doppeltblickende Vorgehen wird gerade wiederaufgelegt und dabei ausgeweitet von der Drittgenerationerin der École, Andréa Bedi, die wie Gwatirisa in Kapstadt mit dabei war.
Bedis doppelter Blick richtet sich auf die Darstellung von ‚Fremdheit‘ in zwei Prosatexten, die zwar gemeinsame Schauplätze und Gegenreisen aufweisen (Westafrika – Paris) und die Ambivalenzen und Alteritätserfahrungen bereits im Titel andeuten. Thomas Stangls Fremde Verwandtschaften und Cheikh Hamadou Kanes L’aventure ambiguë stempeln aber mit markant unterschiedlichem Datum; der Österreicher publizierte seinen Roman 2018, der frankophon schreibende Senegalese veröffentlichte seine Erzählung 1961.
Der regard croisé der beiden Texte auf- und zueinander dürfte so spannend werden wie das, was sie zur Auswahl just dieser zwei Romane unter dem universalen Gesichtspunkt ‚des Fremden‘ zu sagen hat. Die Klemme, der sie sich dabei stellen muss, ist keine des Vergleichs von eigentlich Unvergleichbarem wegen Unterschieden beim zeithistorischen Hintergrund: Bedis Wahl dieser beiden publikationsdatumsverschiedenen Primärwerke ist eine schlicht so getroffene. Es ist bei aller Überbietungsnotwendigkeit und Innovationsfreude (‚fremd‘ statt ‚Nullstunde‘, ‚Hunger‘ oder ‚Vaterfunktion‘) eher eine Klemme des möglicherweise übersehenen Offensichtlichen.
Dieses Offensichtliche zum Ausdruck brachte derselbe Ngugi wa Thiong’o, der schon mal angeführt wurde. Für Bedis Literaturauswahl und Fragestellung lohnt es sich, bei ihm auch hier mal nachzufassen, schließlich äußerte wa Thiong‘o 1986 am Beispiel von ausgerechnet Cheikh Hamidou Kanes Roman Grundlegendes zum neokolonialen Projekt europäischer Entwicklungs-, Wirtschafts- und vor allem (Hoch-)Schulpolitik in Afrika. Es geht um den für die Germanistik als akademisches Fach zentralen, von ihr aber unkritisch (fort)geführten, also auch nie doppeltblickend in eine Analyse einbezogenen Aspekt der Bildung.
Wa Thiong’o formuliert den Neokolonialismus, der über schulische und universitäre Bildung läuft, sehr plastisch:
„Schwert und Gewehrkugel führten zum Berlin des Jahres 1884. Der Nacht des Schwertes und der Gewehrkugel aber folgt der Morgen der Kreide und der Schultafel. Die physische Gewalt des Schlachtfeldes wurde von der psychischen Gewalt des Klassenzimmers abgelöst. Wohingegen ersteres jedoch sichtlich brutal war, war letzteres sichtbar sanft, ein Prozess, der in Cheikh Hamidou Kanes Roman L’aventure ambiguë beschrieben ist, in dem er über die Methoden der kolonialen Phase des Imperialismus spricht, in der man effektiv zu töten weiß und ebenso kunstfertig zu heilen“.
Damit bauchredet Wa Thiong’o Cheikh Hamidou Kane und er zitiert also wörtlich und lang, wie der in seinem Roman ‚die neue Schule‘ (l’école nouvelle) aufziehen sieht im zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 1961 seit einem Jahr von Frankreich unabhängigen Senegal:
„On commença, dans le continent noir, à comprendre que leur puissance véritable résidait, non point dans les canons du premier matin, mais d’ans ce qui suivait ces canons. Ainsi, derrière les canonnières, le clair regard de la Grande Royale des Diallobé avait vu l'école nouvelle. L'école nouvelle participait de la nature du canon et de l'aimant à la fois. Du canon, elle tient son efficacité d’arme combattante. Mieux que le canon, elle pérennise la conquête. Le canon contraint les corps, l'école fascine les âmes” [Wa Thiong’o lässt es so Bachir Diagne übersetzen: ‚Auf dem schwarzen Kontinent begann man zu verstehen, dass ihre eigene Macht nicht im mindesten auf den Kanonen des ersten Morgens beruhte, sondern auf dem, was den Kanonen folgte. Deshalb stand hinter den Kanonen die neue Schule. Die neue Schule besaß sowohl die Natur der Kanone als auch des Magneten. Von der Kanone bezog sie die Wirksamkeit der Kampfeswaffe. Doch besser noch als die Kanone verlieh sie der Eroberung Dauer. Die Kanone zwingt den Körper und die Schule zieht die Seele in ihren Bann‘].
‚Bildung‘ als das neokoloniale Terrain par excellence lässt sich auch bei denen, die heute antreten, um in (West-)Afrika Lernen anzuleiten und zu lehren, selbstreferentiell neben die anderen Ankerbegriffe der Hannoverschen Schule platzieren: Bildung als offenbar nicht voraussetzungsloses, sondern seit der kolonialen Zeit verschuldetes und derzeit vielen Transformationen wie dem Zusammenschnurren der Welt durch Digitalisierung zu einem global-dörflichen Klassenraum unterworfenes Konzept.
Das ist eine zugegeben spitze Diagnose, an der aber Spuren von Wahrheit kleben. Erinnert sei an das zeitgleich propagierte Unterrichten von Deutsch als Sprache-Kultur, das bei Interkulturalitätsgermanisten einher ging mit dem illustren Ideal einer ‚Kulturmündigkeit‘ der Unterwiesenen.
Ausgewogen geht anders. Nur wie lässt sich Bildung denken im sprachen- und kulturübergreifenden Kontext? Mit Deutsch als Fremdsprache und damit Teil dieser Nummer? Wie könnte sowas gehen, heute und vor allem wenn man möchte, dass die Paradoxien einer kolonialverschuldeten und neokolonial neu aufgelegten Einseitigkeit in puncto Sprache und ihrer Funktion vermieden werden? Wie entgeht man den drei bis vier Klemmen, die verstrickungsgeschichtliche und zeithistorische sind, aber nicht nur, sondern im Fall der längst großelterlich gewordenen École d’Hanovre auch solche der akademischen Spielregel, dass Forschungsstände zu referieren und mit dem eigenen Tun verbessern sind?
Der Vorschlag wäre ein Denken außerhalb dieser Klammern und Klemmen und vor allem eine kühle Bestandsaufnahme von dem, was es heute – anders als vor sechs oder vier Jahrzehnten – gibt an Praxen und Ausdrucksformen von Afrodeutschsein, die mal dem entsprechen, was standardisiertes und kanonisches Deutsch ist, und mal nicht. Migration und Exilierung wie die der ‚DDR-Kinder von Namibia‘ mit ihrem Oshideutsch haben diesen Unterschied herbeigeführt, auf den man verfallen kann: aber nicht nur sie. Auch afrikanische Deutschversierte aus der Kolonialzeit könnte man heranziehen. Warum nicht sie und ihre deutschsprachigen Zeugnisse, die sie hinterlassen haben, als Grundlage nehmen, sie didaktisch klug und normabweichungstolerant aufbereiten zu einem Syllabus für Deutsch als afrikanische Fremdsprache, die genau besehen längst keine mehr ist?