Erkenntnisfragen
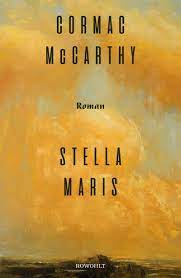
In einem Interview sagte Cormac McCarthy einmal, er könne mit Schriftstellern, die sich nicht mit grundsätzlichen Fragen über Leben und Tod auseinandersetzten, wenig anfangen. Bekannt ist auch, dass er sich lieber mit Wissenschaftlern als mit Literaten austauscht. Das nimmt mich für ihn ein. „Nennen Sie mir eine Sache, die unsere Welt besser macht als die von 1900 und nicht der Wissenschaft zu verdanken ist.“
Alicia, eine attraktive zwanzigjährige Doktorandin der Mathematik an der University of Chicago liefert sich selbst in die Psychiatrie ein. Sie kennt die Einrichtung von zwei früheren Aufenthalten. „Ich wollte hier einige Leute sehen.“ „Patienten.“ „Ja.“ „Denken Sie, ich komme her, um das Personal zu besuchen?“ „Sie meinen die Ärzte.“ „Ja.“ Er sei überrascht, dass sie sich in einer psychiatrischen Anstalt heimelig fühle, sagt der Psychiater. „Vielleicht will ich nur die Nachsicht ausnutzen, die man Verrückten entgegenbringt (...) ich glaube, alle hier sind sich ziemlich einig, dass alle anderen, die hier sind, tatsächlich hierher gehören. Wo sonst findet man das?“
Dieses Aufnahmegespräch gehört zu den faszinierendsten und packendsten Texten, die ich kenne. Es ist gescheit, witzig, herausfordernd und von einer No-nonsense-Atmosphäre geprägt – mehr philosophischer als therapeutischer Dialog, und darüber hinaus auch ein Spiel. Der Psychiater weiß nicht immer, ob Alicia ernst meint, was sie sagt. Und sie selbst weiß es auch nicht immer.
Von der Mathematik ist die Rede und von der Literatur und von Halluzinationen wie auch von Satan. „Die Kirche hört nie auf, von Sündern zu sprechen. Die Geretteten werden kaum erwähnt. Jemand hat mal darauf hingewiesen, dass Satans Interessen ausschließlich spiritueller Natur sind. Chesterton, glaube ich.“
Alicia mag keine Tests, hält es für rassistisch, dass bei diesen nie Musik abgefragt wird, denn ein Mensch mit einem kleinen IQ kann durchaus ein musikalisches Genie sein. Auch die Therapie wird thematisiert („Der Therapeut muss glauben, dass die Patientin die Ärztin ist. Dass sie die Wahrheit über sich selbst enthält.“).
Von den Ärzten hält Alicia nicht viel. „Ich könnte sie fragen, wofür sie ihrer Meinung nach bezahlt werden. Sie wollen entweder meine Wahnvorstellungen oder meine Vorliebe für Lügen erklären, aber in Wirklichkeit können sie gar nichts erklären. Meinen Sie, eine Patientin mit Wahnvorstellungen wäre leichter zu behandeln als eine, die nur glaubt, welche zu haben? Wie das schon klingt. Jedenfalls bin ich über Erklärungen längst hinaus. Ich bin fertig.“
Stella Maris handelt hauptsächlich von Erkenntnisfragen, bei denen unter anderen Kant, Wittgenstein, Bischof Berkeley und Schopenhauer zur Sprache kommen. Schlecht weg kommt besonders C.G. Jung. Die Lust und Freude am Denken springt den Leser geradezu an.
Ihr Vater, ein Physiker, war am Manhattan Project beteiligt, ihre Mutter ebenfalls; ihr Bruder ist hirntot. Über ihren Vater sagt Alicia: „Ich glaube, für ihn gehörte das, was einer glaubte, zum Charakter. Er wäre nicht auf den Gedanken gekommen, dass an Gott zu glauben – oder nicht zu glauben – eine bewusste Entscheidung sein könnte. Wahrscheinlich war man eben einfach gläubig oder auch nicht.“
Stella Maris ist amüsant, witzig, unterhaltsam, clever, herausfordernd und ausgesprochen lehrreich. Und was ich über Musik, über die ich zu meinem Erstaunen noch gar nie wirklich nachgedacht habe, obwohl ich in jungen Jahren mich intensiv damit beschäftigte und in einer Rockband sang, gelernt habe, war für mich sehr erhellend. „Musik besteht aus nichts als ein paar ziemlich einfachen Regeln. Die Wahrheit ist, dass niemand sie sich ausgedacht hat. Die Regeln. Die Töne selbst bedeuten fast gar nichts. Aber warum sich ein bestimmtes Arrangement dieser Töne so stark auf unsere Emotionen auswirkt, ist ein Geheimnis, das zu ergründen wir nicht mal hoffen dürfen. Musik ist keine Sprache. Sie bezieht sich auf nichts anderes als sich selbst.“
Stella Maris ist ein sehr dichter Text, den langsam zu lesen lohnt. Klar wird mir dabei unter anderem, dass die sprachlichen Grenzen, an die man beim Nachdenken und Argumentieren stößt, beileibe nicht so eng gezogen werden müssen, wie unser ausschließlich auf Nützlichkeit programmiertes Denken uns weismachen will.
Die vielfältigen Einsichten, die Stella Maris offenbart, beglücken mich, weil sie tiefe Wahrheiten formulieren. Als der Psychiater fragt, ob Verrückte einen Sinn für Gerechtigkeit hätten, antwortet Alicia: „Ist das eine ernst gemeinte Frage? Sie rasen. Nichts beschäftigt sie so sehr wie Ungerechtigkeit.“ Und als er von ihr wissen will, ob sie glaube, dass der Therapeut nicht sonderlich viel heilen kann, sagte sie: „Ich glaube, was die meisten Leute glauben: Heilung kommt durch Zuwendung, nicht durch eine Theorie.“
Hans Durrer
Cormac McCarthy: Stella Maris, Rowohlt, Hamburg 2022