Kognitive Armut
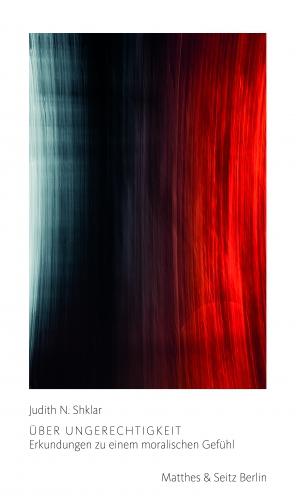
In einem wiederaufgelegten Essay mit dem Untertitel Erkundungen zu einem moralischen Gefühl untersucht Judith Shklar (1928–1992) das „unterschätzte politische Problem“ der Ungerechtigkeit. Die breit angelegte Studie schlägt von Aristoteles, Platon, Augustinus, Montaigne, Hume, Voltaire, Rousseau etc. einen philosophiegeschichtlichen Weg ein, dessen wesentliche Komponente aber zusätzlich auf Miteinbezug von Literatur, wie dem Gerichtsroman Die Pickwickier von Charles Dickens, Michael Kohlhaas, Giottos Fresken oder geschichtlichen Vorkommnissen wie dem Erdbeben von Lissabon oder Bostoner Bränden und anderen Kriminalfällen, beruht. Anschaulich gelingt es Shklar in zugänglicher, fast bescheidener Argumentationssprache die Ungerechtigkeit aus ihrem Schattendasein als „bloße Anomalie von Gerechtigkeit“, letzteres die wesentlich häufiger behandelte Themenseite, zu heben um letztlich der Frage nachzugehen, wo die Grenze zwischen Ungerechtigkeit und Unglück eigentlich zu ziehen sein könnte. Letztlich endet das Buch etwas mager mit der Feststellung, dass diese Grenze gar nicht zu ziehen sei. Doch auf dem Weg dorthin, wird „mit einer Lücke im Wissen“, aufgeräumt, die den Skeptikern Platon oder Montaigne kaum mehr als ihre bloße Existenz anzunehmen – wie der große Blockierer – wert war zu beschreiben. Shklar hingegen formuliert das letztlich didaktisch konnotierte Konzept der passiven Ungerechtigkeit. „Unter passiver Ungerechtigkeit verstehe ich nicht unsere gewohnheitsmäßige Gleichgültigkeit gegen das Elend anderer, sondern ein weitaus begrenzteres und spezifisch staatsbürgerliches Versagen, privaten und öffentlichen Akten der Ungerechtigkeit Einhalt zu gebieten.“ Als ein Beispiel führt sie die irische Hungersnot im 19. Jahrhundert an. Jeden Tag heute lässt sich gewiss ein unendliches Listenarchiv anfügen.
Weiterhin scheine sich tiefverwurzeltes Missverstehen bzw. Missdeuten von Unglück im Geisteswesen verbreitet zu haben. Mit Blick auf jüngste Krisen eine ziemlich aktuelle Feststellung: „[...] auch unter Psychologen ist es eine geläufige Beobachtung, dass es den meisten Menschen angenehmer ist, Verschwörungen zu wittern, als anzuerkennen, dass überhaupt niemand verantwortlich ist. Sie beweist unser Bedürfnis zu beschuldigen und anzuklagen.“ Opfer zu werden, hieße nach Shklar trotzdem, „weil Ungerechtigkeit eben unser Schicksal ist“, oft gerade nicht Gerechtigkeit anzufordern im Gerichtsweg, sondern stattdessen zu resignieren, worin sie den „offensichtlichen Grund“ sieht, „warum wir vielleicht nie das wirkliche Ausmaß der Ungerechtigkeiten [...] erfahren werden, das unter uns herrscht.“
„Aber ist das richtig? Wie viel Ungerechtigkeit ist unvermeidlich und wie viel ist menschlichen Entscheidungen und Handlungen geschuldet? [...] Welche Entscheidung wir auch immer treffen, sie wird so lange ungerecht sein, wie wir der Perspektive der Opfer nicht uneingeschränkt Rechnung tragen.“
Heute würde dieser Stoff sicherlich noch wesentlich radikaler unterfüttert und vehementer vorgetragen werden. Dennoch bleibt Shklars Untersuchungsfokus eben deshalb ungebrochen dringend wie zeitlos aktuell. So etwas wie ein Standardwerk, ungerechterweise spät entdeckt bzw. anerkannt, sozusagen ganz im Sinne seiner inhaltlichen Performanz.
Jonis Hartmann
Judith Shklar: Über Ungerechtigkeit. Matthes&Seitz, Berlin 2021
https://www.matthes-seitz-berlin.de/buch/ueber-ungerechtigkeit.html