Pressestimmen
Rechts-Qualitätsprüfer Querulant

Schon auf dem Weg zu ihren Erforschern war querulatorische Rechtschaffenheit im Spiel. Man werde noch sehen, wohin das führe - das Fahren ohne Fahrradlampe. Es sei in jedem Fall anzuzeigen und zu sanktionieren. Die zarte Berührung der Kühlerhaube des aufgebrachten Kleinwagenbesitzers mit dem Opossumfellhandschuh der Radfahrerin wurde sofort als Gewalteinwirkung missverstanden, woraufhin die Hupe zum Einsatz kam und noch mehr wüste Androhungen von rechtskräftigen Verurteilungen auf die Gerügte niederprasselten. Um ein Haar wäre sie zu spät zu einer Diskussion im "Institute of Cultural Inquiry" gekommen. Ein ehemaliger Richter sollte sich dort mit zwei Kulturwissenschaftlern über querulatorische Biographien verständigen. Entgegen populärer Deutungen, hieß es, seien diese keineswegs auf die Privatpathologie der Frustrierten und Zukurzgekommenen zurückzuführen. Die Querulanz ergebe sich vielmehr durch die akkurate Anwendung zeitgenössischer Rechtsmittel. Die krankhaft querulierende Persönlichkeit wiederum sei ein Produkt der modernen Psychiatrie. Nachdem in Preußens allgemeiner Gerichtsordnung von 1793 das Rechtsmittel der Klage eingeführt worden war, sah sich die dortige Justiz bald von der schieren Masse der Anträge überfordert. Die sich im neunzehnten Jahrhundert neu formierende Disziplin der Psychiatrie leistete Schützenhilfe und sah sich bald in der Lage, die brenzlige Situation in den Griff zu bekommen. Der "exzessive Rechtsanspruch" Einzelner wurde mit Hilfe der Seelenkunde in den Verantwortungsbereich des Subjekts verlegt und damit pathologisiert; der jetzt "Querulant" genannte hartnäckige Kläger wurde als Rechtsperson unmöglich gemacht. Wie das neunzehnte Jahrhundert diesen Typus des infamen Justiztesters hervorbrachte, zeigte die in Berlin vorgestellte Studie "Querulanz. Skizze eines exzessiven Rechtsgefühls" des Bochumer Medienwissenschaftlers Rupert Gaderer (F.A.Z. vom 15. August). Etymologisch weist der Begriff der "querela" in drei ganz unterschiedliche Richtungen. Zum einen ist mit ihm die Produktion von Klagelauten bezeichnet, zum Zweiten die musikalische Klage und zum Dritten die Klage vor Gericht. Seit dem späten achtzehnten Jahrhundert löste die Querele als Rechtsmittel die verbreitete Praxis der Privatfehde ab. Doch die Justiz kann nicht bewältigen, was sie hervorbringt. Bald, so Gaderer, wird der Begriff "Querulant" in zahlreichen Wörterbüchern geführt. Er soll die Bevölkerung mit dem unrühmlichen Phänomen bekannt machen und abschreckend wirken. Nicht nur die schriftlich verfasste Querele, entstanden aus Bittschriften, soll Anomalitäten in der Rechtsauslegung aufdecken, auch Wörterbücher sollen adäquate von inadäquaten Verhaltensweisen unterscheiden helfen. Querulantentum gilt um 1900 als inadäquat und fällt damit bald in den Zuständigkeitsbereich der Medizin, die bestimmen soll, wann die Grenze zum Exzess überschritten ist. "Die Psychiatrie hat das Mandat, die Krankheit zu benennen und gesellschaftlich zu intervenieren", präzisierte der Lübecker Wissenschaftshistoriker Cornelius Borck. Die Disziplin springe aber auch aus Gründen der Profilierung und Professionalisierung auf den Casus des Querulanten auf. Im Gegenzug wird diagnostisch festgelegt, was ein geregelter psychischer Apparat sei. Querulanten-Wahn und Querulanten-Paranoia sind in dieser Zeit geprägte und viel verwendete Begriffe. Abweichler aller Art können durch diese Schematisierung rhetorisch dingfest gemacht werden. Obwohl der Querulant nie die Dignität von Michel Foucaults wahrheitskreativen "Wahnsinnigen" erlangt habe, gab Borck zu bedenken, ließe er sich als sozial verfemter Typus durchaus in den Kontext der Antipsychiatrie einordnen. Anteil an dieser neuen einfühlsameren Sichtweise hat die Literatur. Mustergültig spielt Heinrich von Kleist in seiner Rebellionsnovelle "Michael Kohlhaas" das Dilemma zwischen juristischer und moralischer Rechtsauslegung durch, und konkret, daran erinnerte der Rechtstheoretiker Thomas-Michael Seibert, zwischen sächsischer Justiz und vormodernem Fehdewesen. Denn der Kohlhaas-Fall hatte den Fall Kohlhase aus dem sechzehnten Jahrhundert zum Vorbild. Bei Kleist wird das Wesen des rechtsuchenden Rosshändlers neu bewertet, und zwar weder medizinisch, noch juristisch, sondern überraschenderweise sprachkritisch. Der Querulant Michael Kohlhaas hat in Kleists Novelle nämlich vor allem eines: ein Kommunikationsproblem. Tragisch könnte man diesen oft unermüdlich Briefe schreibenden und nicht gerade sympathischen Zeitgenossen deshalb nennen. Oft bleibt er als isolierter Verlierer zurück und nimmt seinen sozialen und finanziellen Ruin in Kauf. "Der, der sich an die Institution drängt, riskiert auch seine Freiheit" - so schloss Thomas-Michael Seibert die gut besuchte Veranstaltung und gab dem Publikum noch einen Satz von Niklas Luhmann auf den Weg: Zum Leben gehöre doch der rechte Sinn für das Dahingestelltsein.
Rupert Gaderer: Q – Querulanz, 100 Seiten, 12 €, ISBN: 978-3-941613-86-7
KATHARINA DEUTSCH, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.11.2012
Querulanz

Wirtschaft als das Leben selbst
Am Institut für kulturelle Inquisition (ICI) wurde neulich über Querulanz diskutiert. Anlaß war die Veröffentlichung eines Beitrags zum Buchstaben »Q« im »Stimmungsatlas« des Hamburger Textem-Verlags. »Q«-Autor Rupert Gaderer, Medienwissenschaftler aus Bochum, faßte seine Überlegungen zusammen. Für weitere Erhellung des Querulanz-Komplexes sorgten ein Jurist, ein Medizinhistoriker und eine Kriminalitätsexpertin. Das Podiumsgespräch fand unter einem an die Wand projizierten Kreuzberger Mauer-Graffito statt: »Ich verschaffe mir Recht M.K.« Dazu zitierte Gaderer Roland Barthes: »Die Mauer ist das Medium unserer Zeit.« In Kairo nannten sich die arbeitslosen Jugendlichen »Mauerstützen«, die um den Tahrirplatz entstande »Mauerkunst« hat inzwischen Berliner Kunstgalerien erreicht. Das »M.K.« unter dem Graffito stand für »Michael Kohlhaas«.
Bevor dieser Pferdehändler im 16. Jahrhundert als Querulant hingerichtet wurde, war er drauf und dran, einen Aufstand zu entfesseln. Für seine Begnadigung setzte sich deshalb auch Martin Luther beim Kurfürsten von Sachsen ein. Postum wurde »M.K.« in der Rechtsgeschichte populär. In Heinrich von Kleists »Lehrnovelle« aus dem Jahr 1808 gerät er zwischen das alte Fehde- und das neue Staatsrecht, das als »Allgemeine Gerichtsordnung für die preußischen Staaten« für jedes Rechtssubjekt bindend werden soll. Schon wird es von Bittstellern bestürmt. Kleist selbst war eine Zeitlang in einer preußischen Domänenkammer mit dem Abschmettern von Eingaben (den »allerdevotesten Supplicken«) befaßt.
Noch in Goethes Weimar wurden Anwälte, die Bauern beim Abfassen von Beschwerden halfen, bestraft. Heute kämpfen wir umgekehrt gegen querulatorische Anwälte, die sich neue Inkassogebühren und hanebüchene Abmahnungen wegen Urheberrechtsverletzungen ausdenken. Während zur anderen Seite hin die oberste Beschwerdestelle, das Bundesverfassungsgericht, sich noch effektiver als bisher vor uns, den Querulanten, hüten will. Nämlich mit einer »Mißbrauchs-« und jetzt auch »Mutwillensgebühr«.
Zum Selbstschutz erfand der preußische Staat den »Querulanten«. Die entstehende Psychiatrie stand ihm mit der Erfindung des«Querulantenwahnsinns« bei. Um der Diagnose zuvorzukommen, beließ der historische »M.K.« es nicht bei Wutausbrüchen und Flugblättern, sondern trat laut Gaderer »zu sich selbst in ein juristisches Verhältnis«. Seine »parasitäre Mimikry« ist heute die Regel. Wir verstellen uns beim Einarbeiten in die juristische Sprache fast selbstverständlich.
Gaderer wandte sich dann einem weiteren Text zur Querulanz zu, »Der Heizer« (1913) von Kafka, welcher tagsüber als Jurist in einer Versicherungsanstalt Beschwerden bearbeitete und nachts die Labyrinthe der Macht aus der Sicht eines Bürgers beschrieb, der darin sein Recht einfordert.
1917 war die Querulanz modern geworden, als »Krankheit des versicherten Lebens«, wie ein Medienprofessor diagnostizierte: »Keine Paranoia querulatoria ohne Entschädigungspflicht.« Fortan versuchten die Gerichte, den Unterlegenen »mit guten Gründen davon zu überzeugen, daß er Unrecht hatte«. Das aber bleibe schwer einzusehen, deshalb »erscheinen fast alle, die vor Gericht stehen, als ›Querulanz-Verdächtige‹«. Oder wie Nietzsche meinte: »Ich aber lasse mich gerne betrügen, um mich nicht vor Betrügern schützen zu müssen.«
Rupert Gaderer: Q – Querulanz, 100 Seiten, 12 €, ISBN: 978-3-941613-86-7
Helmut Höge, Junge Welt 04.12.2012
Deutsche mögen niederländische Frikandel nicht

Das Thema: „Igitt-Kochbuch“
Im Interview: Markus Binner, Künstler
Zur Person: Markus Binner ist Künstler in Berlin. Er hat 50 Menschen befragt, welche Gerichte sie aus dem Nachbarland nicht mögen.
Frage: Herr Binner, in Ihrem Buch beschäftigen Sie sich mit den kulinarischen Abneigungen in der deutsch-niederländischen Grenzregion. „Das mag ich nicht – Dat lust ik niet“ lautet der Titel Ihres besonderen Kochbuchs, in dem Rezepte, die in dem jeweiligen Land auf Ablehnung stoßen, veröffentlicht werden. Was mögen denn die Niederländer nicht so gern?
Binner: Gekochten Teig. Spätzle, Knödel in allen Formen, das ist den Niederländern oft zu schleimig, zu eklig, das stößt grundsätzlich auf Ablehnung. Oft ist ihnen das deutsche Essen zu fettig, zu sauer, zu stark gewürzt. Schwarzbrot ist auch so ein Klassiker.
Frage: Und umgekehrt. Was mögen die Deutschen nicht?
Binner: Umgekehrt sagen die Deutschen über das niederländische Essen, dass es gar nicht gewürzt ist. Und Brot gebe es nicht. Die Deutschen mögen oft die frittierten Sachen nicht, Frikandel zum Beispiel. Das wird am häufigsten genannt, das ist ihnen unheimlich, weil man ja auch nicht weiß, was drin ist.
Frage: Es gibt also viele Unterschiede – und das ist Ihrer Meinung nach wichtig für die Identität?
Binner: Ja, ich glaube, es sagt etwas darüber aus, wie man mit Essen umgeht. Es gibt ja die Geschichte aus dem Dreißigjährigen Krieg, als die Spanier mit den Niederländern verhandelt haben. Die Spanier haben ihre Speisen auftafeln lassen, und die Niederländer haben ihr eigenes Essen mitgebracht.
Frage: Wen haben Sie denn befragt für Ihr Buch?
Binner: Ich habe vor allem die befragt, die etwas mit Essen zu tun haben.
Frage: Wen beispielsweise?
Binner: Vom Bauern bis zum Sternekoch. Wir sind eine Woche in der Grenzregion herumgefahren. Die Reaktionen waren genau umgekehrt als die, mit denen wir gerechnet hatten.
Frage: Womit haben Sie denn gerechnet?
Binner: Im Vorfeld hatte man mir gesagt, du wirst auf niederländischer Seite Probleme kriegen, es wird um den Krieg gehen, und die Deutschen werden sich leichter damit tun. Am Ende war es anders herum. Die Deutschen haben ganz oft gezögert. Die Spitzenköche wollten darüber nicht sprechen. Die Niederländer waren dagegen sehr aufgeschlossen. Da kam mehrfach der Spruch: „Wieso der Krieg, den haben wir doch gewonnen.“
Markus Binner: Das mag ich nicht - Dat lust ik niet. Ein Forschungsbericht
88 Seiten, vierfarbig, zahlreiche Abbildungen, alle Rezepte, deutsch-niederländisch, Broschur, 148 x 210 mm, Texte von Markus Binner, Eva Sturm12 Euro, ISBN 978-3-86485-032-5
Elmar Stephan, NWZ 20. 12. 2012
Batman & Robin

Der Protagonist: "weiß, groß (1,89 m), männlich, dunkelhaarig, blauäugig, muskulös (100 kg), kantig. Und selbstverständlich unbeweibt". So stellt der Berliner Literaturwissenschaftler Dick Linck in seinem kleinen Band "Batman & Robin" (Texten Verlag) seinen Untersuchungsgegenstand vor. Es geht um den Weg des fledermausigen Milliardärs in Kunst, Literatur, Schwulen- und Popkultur: Jack Smith spielte ihn in Andy Warhols verschollenem Film "Batman / Dracula" (1964), Rolf Dieter Brinkmann dichtete über Sex im Batcave. Der Band schlägt mit Lincks kleinen (großen), bombig formulierten Beobachtungen in den Bann - etwa, wenn es um Moralhüter in den 1950ern geht: "Die Comic-Gegner jener Jahre haben das Genre ganz richtig begriffen. Nur übersahen sie, als sie in distanzierter und zerstreuter Weise über den Genuss der Unkultur und die Unkultur des Genusses zu sprechen begannen, dass jeder Genuss die Kultur überrascht, in der er sich ereignet, und jede Lustempfindung die Suspendierung der signifikanten und symbolischen Ordnung bedeutet." Noch drei so Sätze: "Traditionalisten unter den Batman-Fans empfinden für Robin wie Beatles-Fans für Yoko Ono: Er ist schuld am Imageschaden des Helden. Bevor er da war, gab es dieses Gerede nicht."
Dirck Linck: Batman & Robin, 100 Seiten, 12 Euro, Textem Verlag 2012
JK, Frieze d/de Winter 2012/13
Stabile Seitenlage

Selbstständig atmend, aber nicht ganz bei Bewusstsein: Der Kulturbetrieb.
Wie in der letzten testcard geht es hier um das Prekariat im weitesten Sinne. Und die dreizehnte Ausgabe von Kultur & Gespenster ist irgendwie schräg, nämlich schief abgeschnitten – stabile Seitenlage oder statische Schläue, wie März-Verleger im Editorial sagt. Das Ding hält und im Falle von Gustav Mechlenburg, Jan-Frederik Bandel, Nora Sdun und Christoph Steinegger, die das Ding bei Textem herausbringen, seit 2006.
Neben der FDP, den Finanzmärkten, Griechenland, den Geschlechterverhältnissen und der parlamentarischen Demokratie ist auch die Universität in der Krise. Entdemokratisierung, Konkurrenz, Einflussnahme und neoliberale Denkmuster sind nur einige der Punkte zum Zustand der deutschen Hochschulen in der lesenswerten Schrift von Pierangelo Maset und Daniela Steinert. Der amerikanische Professor William Pannapacker ergänzt den Schwerpunkt mit seinen Kolumnen, in denen er unterhaltsam vom Promovieren in den Geisteswissenschaften abrät.
Eine universitäre Krise anderer Art ereilte eine Studentin im Jahre 1966. Sie wandte sich an ihren Professor Theodor W. Adorno, nachdem sie die Sommerferien mit der Lektüre seiner Werke verbrachte und depressiv wurde. Adorno antwortet: „Schönsten Dank für Ihren Brief, er hat mich sehr bewegt“, und schlägt ein Treffen vor. Er warnt vor unüberlegten Handlungen, das richtige Leben im Falschen betreffend: „Der Weg vom Denken zur sogenannten Praxis ist viel verschlungener, als man es im allgemeinen heute sich vorstellt.“
Weniger feinfühlig ist der Rat an einen schwulen Wiener Kunststudenten, der sich vollkommen verzweifelt an Adorno wandte. Er bitte um Verständnis, dass er sich nur ums Prinzipielle und nicht um Einzelfälle kümmern könne und „nicht die leisesten Neigungen nach dieser Richtung“ verspüre.
Manchmal mag die Popularität des Denkers in der Praxis aber doch helfen: Beim geplanten Ausbau einer Straße in Amorbach im Odenwald nutzt er sein durch heimatliche Gefühle erworbenes „geistiges Mitspracherecht“ und wendet sich an die Herren von der Stadtverwaltung. Die von Philipp Felsch und Martin Mittelmeier ausgegrabenen und kommentierten Korrespondenzen im Faksimile sind sehr unterhaltsame Dokumente. „Ich war ehrlich überrascht und erschrocken, wie umfangreich Sie geantwortet haben“, gibt einer der Briefschreiber zu.
Außerdem finden sich im – wie immer – hochwertig gestalteten Heft Gedanken zum Aufsatz „Der Künstler und die Zeit“ des Dada-Mitbegründers Hugo Ball zum Verhältnis von Wissenschaft, Kunst und Religion, ein Gespräch mit dem Soziologen Joachim Häfele zur Broken-Window-Theorie, in dem erläutert wird, wie das Streben nach Kontrolle die Stadtentwicklung beeinflusst. Als Hochglanz-Spezial gibt es eine Rückschau auf den Ausstellungszyklus „Reihe:Ordnung“ des Kunstvereins Harburger Bahnhof. Und der schöne Titel „Ein Gespräch über die Liebe zur Kunst und wie man in Persien Affen fängt“ von Paul Maenz sowie Fotos von Heiko Neumeister und bunte ornamentale Zeichnungen von Anke Wenzel. Cousin Edward kommt in einem Comic von Jul Gordon zu Besuch und lässt sich die Nägel lackieren.
Die Kultur & Gespenster scheint zur testcard ein ähnlich verwandtschaftliches Verhältnis zu haben. Die schicke Cousine aus Hamburg, dem verarmten Adel entstammend, mit weniger Platten im Schrank, aber richtiger Kunst an der Wand.
Kultur & Gespenster #13. Stabile Seitenlage, Textem Verlag 2012
Fiona Sara Schmidt, testcard 22
Bildzweifel
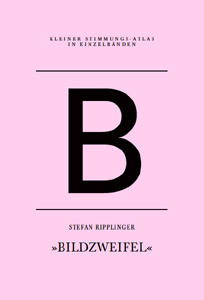
Das ähnlich gemachte Andere. Vom Risiko des „Bilderzweifels“
Wir leben mit Bildern und verstehen die Welt immer mehr durch Bilder – gerade auch und besonders dann, wenn wir die Welt, in der wir leben nicht mehr verstehen. Wenn „schreiben heißt, sein Herz waschen“ (Fritz J. Raddatz), was heißt dann überhaupt an (herrschenden) Bildern zu zweifeln? In der Reihe „Kleiner Stimmungs-Atlas in Einzelbänden“ des kleinen feinen Textem Verlages versucht Stefan Ripplinger in elf eng mit einander verbundenen Kapiteln das Geheimnis des Bildes in Form des produktiven Zweifelns auszuloten: ob das philosophische Zweifeln an der platonischen Wahrheit des Bildes, die Frage nach der angemessenen Wertung von Bildern, der Versuch Gottes die Grenzenlosigkeit in Bildern zu fassen, die politische Instrumentalisierung durch die vielfältigen Formen des Ikonoklasmus oder die Versuche von Marcel Duchamp die „herrschenden Bildregimes durch Bilder zu kreuzen“ (S. 76) – Ripplinger unternimmt einen schnellen, assoziativ bestimmten Parforceritt durch eine mehrere Jahrtausende andauernde Politik des Bilderzweifels, wobei der Autor gerade am Nichtpassen, die Diskontinuität und der Asymmetrie zwischen Bild und Gegenbild betont. Bilder, so kann mit zwischen den Zeilen Ripplingers lesen, aktivieren unterschiedlichste Bildfunktionen, wie sie etwa in komplexen Begrifflichkeiten wie „Ebenbild“, „Trugbild“, “Denkbild“, „Abbild“ usw. zum Ausdruck kommen. Ripplinger gelingt eindrucksvoll das Kunststück auf achtzig eng bedruckten Seiten den Leser auf eine eigenwillig realisierte Bild/ungsreise mitzunehmen. Der Leser wird - zum Glück - nicht mit fertigen Ergebnissen eines fachwissenschaftlichen Diskurses überfrachtet, sondern vielmehr mit ungelösten, widersprüchlichen und selbstzweifelnden Aussagen zu Bild-Verwendungen konfrontiert. Mit wachsendem Zweifel an dem, was ein Bild leistet, erkennt der Nutzer, wie man seinen Fallen entgehen kann. Wenn es gelingt, stören Bilder die herrschende Kommunikation. Oder, um mit einem vom Autor benutzten Wortbild zu enden: „Das Bild ist der Wurm im Apfel der Metaphysik.“
20.11.2012 Michael Kröger, Kunstbuchanzeiger
TEXTEM VERLAG. Ripplinger, Stefan. B - Bildzweifel. Eine Einzelstimmung. Idee von Steinegger, Christoph; Hrsg.: von Sdun, Nora; Bandel, Jan-Frederik. Pb. Textem Verlag, Hamburg. EUR 12,00. ISBN 978-3-941613-82-9
Wir mögen alles

Ein partizipatorisch-forschendes Kunstprojekt von Markus Binner dokumentiert als Kochbuch
Beim Essen hört Friede, Freude, Pannekoeken doch bei ehemaligen Krigesfeinden auf, oder? Der Künstler Markus Binner reiste in diesem Sommer an die niederländisch-deutsche Grenze und wollte jeweils vom Nachbarn wissen: Welche niederländischen Gerichte lehnst du ab und warum? Und was magst du nicht an der deutschen Küche? Herausgekommen ist das erstaunlich mild gewürzte Kochbuch mit schrägen Rezepten von Gehaktballen oder dem typischen Weißbrot - du beißt rein, und es ist nichts - oder viel zu fettigem Eisbein nebst Bildern und Gesprächsschnipsel der Befragten. Das Reisekünstlerkochbuch erscheint in diesem Herbst. Der 1966 in Nürnberg geborene Künstler Markus Binner studierte Freie Kunst an der HfbK bei Franz Erhard Walter und Michael Lingner. Er arbeitet schon viele Jahre im Forschungsfeld Kunst und Essen, mit Gesprächssituationen und Sprache als Material. Die häufig im öffentlichen Raum angelegten Performances beziehen Bewohner oder wie beim Projekt "Duchampgrillvortrag" von 2009 Grundschüler mit ein. Für "Das mag ich nicht - Dat lust ik niet" interessierte ihn neben der Sozial- und Gerichtestudie auch die Ästhetik des Hässlichen. Anders als in der Malerei oder der Literatur gibt es das beim Kochen nicht. Einverleibung von dem, was man nicht mag, dass es Teil des Körpers wird - hui, bah! Dabei macht es unheimlich Freude herauszufinden, was man nicht mag. Ein schräges und lustiges Buch.
Markus Binner: Das mag ich nicht - Dat lust ik niet, Textem Verlag 20012
o. T. November 2012
Camera Austria

Stefan Panhans: Unsicherbare Dinge
Schon oft wurde über das Uneindeutige in der Kunst von Stefan Panhans – analog zur »Écriture automatique« – geschrieben. Dennoch ist das Treibgut der Kombinatorik der semantischen Zeichen der fotografischen Raum-, Objekt- und Materialcollagen seltsamer als das, wozu der Dichter de Lautréamont sein Statement vom »zufälligen Zusammentreffen einer Nähmaschine und eines Regenschirms auf einem Seziertisch« abgab. Die Surrealisten übernahmen diese Metapher. Meine erste Frage lautet: Liegt das Uneindeutige auch im Habitus des Personals der Videos und in den »prekären« Zeichen begründet? Ja, das sehe ich so. Der Begriff »Prekariat« lässt an Kleinbourgeoisie denken. Nun wird es recht kompliziert. Ist diese »populäre Klasse« doch genau die, wohin die »breite Mittelschicht« nicht abrutschen will. Sie befindet sich ja dauernd in Aufstiegs- und Abstiegsmobilität.
Weil die Videogroteske soziale Räume quasi klassenfraktionell »nach unten« verdreht, schlägt sie hart auf dem Boden der Tatsachen auf. Sie konfrontiert mit veränderten Mechanismen der sich »prekär«6 im Umbruch befindenden Sozialräume. Folgt man dem Begriff »Habitus«, den Pierre Bourdieu zuerst am Realismus des bürgerlichen Romans des 19. Jahrhunderts, an großen Erzählungen Flauberts, Balzacs und Stendhals wahrnahm, bevor er ihn am sozialen Geschehen im 20. Jahrhundert schulte, meinte das Wort außer äußerlichen Reglements schon Grenzen auch »im Inneren« der Personen: Habitus geht in mehrfacher Hinsicht nicht alleine vom Bewusstsein, sondern genauso stets auch vom »Erzeugerprinzip des Unbewussten« aus. Dem Bewusstsein »nur höchst bruchstückhaft«7 zugänglich sind der Habitus und das sozial Kaschierende der Lifestyles. Teilweise unbewusste Triebkräfte sind im Kapitalismus Distinktionsgewinne, die durch den Wettstreit der Lebensstile (symbolische Macht) erzeugt werden. Weil sich hier verdrängte Klassenproblematik auftut, ist auch die Bildregie von Stefan Panhans eine arretierende. Also wird der Begriff surreal mit sozialem Leben gefüllt. An dieser Stelle festzuhalten: Stefan Panhans fertigt Videos/Fotografien mit aller größter Sorgfalt an. Er ist ein um Klarheit ringender Künstler.
GISLIND NABAKOWSKI
Textbeitrag in Camera Austria 119/2012, Seite 39-52.
Buch bestellen unter: http://www.textem.de/index.php?id=2338
In der richtigen Stimmung

Statt fröhlichem Oberflächenwissen lieber das Wagnis einer Universalenzyklopädie: Nichts Geringeres haben sich die Herausgeber des "Kleinen Stimmungs-Atlas in Einzelbänden" vorgenommen, mit dem sie die Kategorien ästhetischer Erfahrung zeitgemäss erweitern wollen.
Fünf solcher "Massnahmen" sind bisher im Hamburger Textem-Verlag erschienen: "Angst", "Albernheit", "Bildzweifel", "Modernität" und "Verkrampfung". Bald folgen "Passivität" und "Querulanz".
Herausgegeben werden sie von der Autorin, Verlegerin und Galeristin Nora Sdun und dem Literaturwissenschaftler und Autoren Jan-Frederik Bandel.
"Albernheit": Ein ebenso anspruchsvoller wie amüsanter Essay von Michael Glasmeier und Lisa Steib, die hier das Anarchische der Albernheit feiern: Sie kenne weder Grund noch Ziel, breite sich hemmungslos aus, ansteckend. Die Autoren setzen das Alberne in Beziehung mit Humor, Ironie und Sarkasmus und all dies wiederum in den Kontext von Kunst, die mit dem Komischen und Witzigen spielt, wie es etwa das Duo Fischli und Weiss stets getan hat. Das Gegenteil dazu ist wohl "Verkrampfung", so der Stimmungsessay von dem Künstler und Ökonomen Armin Chodzinski, der dazu mit einer wunderbar detaillierten Geschichte zur Atmosphäre in der Wartezone eines schwedischen Möbelhauses einsteigt. Sein Essay nimmt Nervosität und Verkrampfung als Paradigmen unserer Gegenwart unter die Lupe.
Ganz so eng mit der Stimmung nehmen es die Macher allerdings nicht, manches wie das Moderne liesse sich eher als eine Haltung beschreiben.
Die Essays sind mal wissenschaftlich, mal gedankenstromförmig, mal heiter, so dass die Lektüre so subjektiv unterschiedlich gefallen dürfte wie die Stimmungen selbst eben auch sind.
Gelungen ist die Erscheinungsform in Jackentaschengrösse: Ein einfacher Pappeinband, die Oberfläche rau und matt statt glänzend und glatt. Die Farben gedeckt: dunkelgrau, blasses Rot oder sandfarben.
Nora Sdun, Jan-Frederik Bandel (Hg): "Kleiner Stimmungs-Atlas in
Einzelbänden". Textem Verlag, Hamburg 2011. Jeweils um 100
S., ca. Fr. 15. -.
sms, BaZ Ausgabe vom 10.06.2012, Seite 36-37
Besprechung
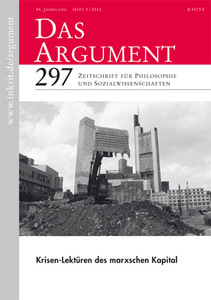
Ott, Michaela, u. Harald Strauss (Hg.), Ästhetik und Politik. Neuaufteilungen des Sinnlichen in der Kunst, Textem, Hamburg 2009 (286 S., br., 16,90 €)
Mit Jaques Rancières Überlegungen zur politischen Differenz (Politik vs. Polizei) rückt das Verhältnis von Politik und Ästhetik wieder ins Zentrum der Philosophie. Der Ordnungsruf »Weiterfahren! Es gibt nichts zu sehen« belegt für ihn schlagartig, wie das Politische als »Intervention in das Sichtbare und Sagbare« vom Polizeilichen zu unterscheiden ist (Rancière, Zehn Thesen zur Politik, 2008, 32f). Ereignisse sind erst dann politisch, wenn sie die unsichtbare, da selbstverständliche Ordnung der Politik sichtbar und kontingent werden lassen. Das Politische ist demnach Platzhalter einer die gesellschaftlichen Felder kreuzenden Praxis, und nicht etwa (nur) Ausdruck des Staates. Die Ästhetik wiederum ist der Politik vorgängig, weil sie festlegt, was zur Sphäre des Gemeinsamen gehört und was nicht. Insofern spricht Rancière bevorzugt vom ästhetischenRegime, um den Begriff des Verhältnisses – der bereits zwei von einander separierte Felder voraussetzt – zu vermeiden.
Der vorliegende, auf eine Tagung an der Hamburger Hochschule für bildende Künste zurückgehende Band zeigt nun, wie gerade diese These den ästhetischen Diskurs belebt, zumal Rancière qua Sinnlichkeit und Sichtbarkeit die Nachfrage der Kunst nach philosophischen Erklärungen terminologisch treffend bedient. Das kann auch zu eher affirmativen Anschlüssen führen, wie in Hanne Lorecks Beitrag »Ästhetische Politiken des Sichtbaren – ein kritischer Vergleich von Clowns und Queers«, der abseits des Titels Rancières Theorie gar nicht braucht. Lorecks historisch anregende, theoretisch vage Schlussfolgerung lautet, dass »der Clown das Symptom einer Wende von den kritischen Differenzdiskursen hin zur anthropologischen Sicht auf Kulturen und Gesellschaften und deren aktuelle Affektbezogenheit« (64) sei. Dieser im Motiv der Sinnlichkeit angelegten Anthropologie misstraut u.a. Hans-Joachim Lenger. Sie entspringe einer fragwürdigen Metaphysik, die schon weiß, wer zur apostrophierten Aufteilung fähig ist und könne zudem die an der Stiftung des Gemeinsamen stets beteiligte Gewalt nicht angemessen theoretisieren. Damit ruft Lenger eine Perspektive auf, die in der Rancièrerezeption zuweilen verlorengeht, weil dessen optimistisches Verständnis der Kunst als Hort der Gleichheit und Ausgangspunkt radikaler Demokratie für den ästhetischen Diskurs so anregend ist – eine Position, die durch Werkstattberichte der Künstlerinnen Michaela Melián und Thomas Hirschhorn am Beispiel eigener partizipativer resp. kritisch-interventionistischer Kunst unterfüttert wird. Dass die Geschichte der Kunst auch von banalen Machtstrategien abhängt, weiß Marie-Luise Knott mit Blick auf die documenta II zu erzählen, deren Programm vom CIA maßgeblich gefördert wurde. Der Begriff der Werkfreiheit verträgt sich durchaus mit dessen Instrumentalisierung, weshalb Sinnlichkeit, Sichtbarkeit und Gleichheit nicht per se für das Politische der Kunst stehen. Hierfür liefert Marion von Osten ein schönes Beispiel mit Helke Sanders Film Redupers. Die allseitig reduzierte Persönlichkeit (1978), der »die Immanenz von Befreiungsidealen und Selbstkontrolle in kapitalistischen Gesellschaften zusammenzudenken versuchte« (190f). Sanders Film problematisiere, wer »Zugänge zur Repräsentation der Welt hat und wer sie selektiert, bestimmt und verwertet« (197), womit von Osten die Aufteilungsthese um eine machtpolitische Dimension erweitert.
Rancière selbst setzt sich in seinem Aufsatz »Bild, Beziehung, Handlung: Fragen zu den Politiken der Kunst« mit Nicolas Bourriauds »relationaler Ästhetik« und Gilles Deleuzes und Félix Guattaris Überlegungen zum Verdrehen/Verbiegen [tordre] der Empfindung« auseinander. Er unterscheidet drei Trennungen im »Feld einer Politik der Ästhetik«, eine räumliche, eine zeitliche und schließlich eine, »die sich innerhalb der Textur der ästhetischen Erfahrung ergibt« (39). »Diese drei Trennungen bestimmen das Feld einer Politik der Ästhetik und zeigen, dass Politik nicht darin besteht, Beziehungen anstelle von Gegenständen zu produzieren. Politik besteht darin, die Konfiguration von Zeiten und Räumen, die das herrschende soziale Beziehungsnetz ausmacht, neu aufzuteilen und zu verteilen.
Diese Neuaufteilung der Räume und Zeiten ist eine Neuaufteilung des Möglichen, d.h. zugleich eine Neuaufteilung der Fähigkeiten.« (40) Rancière aktualisiert das für die Kunst unverzichtbare Begehren nach Neuheit, bezieht es aber explizit auf die Begleitumstände (Netz) der künstlerischen Praxis und setzt sich damit deutlich ab von den Ontologisierungsbemühungen der an Heidegger orientierten Linie der politischen Differenz. Insofern trifft die von Michaela Ott in ihrer Einleitung geäußerte Kritik nicht zu, Rancière nehme zu wenig »die Eingelassenheit des Kunstwerks ins gesellschaftliche Feld« (20) wahr.
Anders verhält es sich mit Dieter Merschs Anmerkung, Rancières Theorie sei auf dem produktionsästhetischen Auge blind. Darum zu folgern, »dass die Kunst dem Politischen notwendigerweise immer schon voraus gegangen sein muss« (129), wie Mersch mit Blick auf Heidegger argumentiert, schießt über das Ziel hinaus und versucht doch (nur), der Kunst und der ihr angeschlossenen ästhetischen Theorie den Platz einer ersten Philosophie zu sichern. Auch Ute Vorkoepers Versuch, den Künstler als »Zeugen« (99) (u.a. im Sinne Emmanuel Levinas’) zu bestimmen, erliegt zu sehr dem alten Geltungsdrang der Kunsttheorie.
Hier vermisst man jene hegemoniale Perspektive, die Knott mit »Konsensdruck« (137) umschreibt, und die in der Lage wäre, die Stellung des Theoretikers zur Kunstpraxis genauer in den Blick zu bekommen. So fragt sich Harald Strauss im letzten Beitrag des Bandes, weshalb Rancière die Zuweisung oder Sichtbarmachung des Politischen der Kunst vom Künstler ablöst – die markante These lautet, »die Kunst sei noch vor dem Künstler politisch« (245) –, nicht aber vom Theoretiker.
Das Argument 2012, Claas Morgenroth (Dortmund)
Buchbesprechung

1979 besorgt sich Michael Glasmeier einen Stempelkasten und einen Schwung unlinierter Leintal-Schulhefte, »holzfrei 80 g«. Damit beginnt eine rege lyrische Produktion über gut zehn Jahre, die hier gesammelt zur Wiederentdeckung angeboten wird: literarische Bild- und konkrete Sprachkritik, Albernes, Urbanes und Landschaftliches. Neben illustrierten Sprüchen Johann Wolfgang Goethes stehen Versuche über die Enzyklopädie der Dinge, über den Walfang und Kamele in Berlin. Komplettiert wird der Band durch ein nicht gar zu arg philologisches Nachwort von Jan-Frederik Bandel und eine vom Verfasser unsentimental kommentierte Bibliografie.
Rezension von Frank Kaspar, WDR 2012
Buchhinweis:
Michael Glasmeier: und zwischen dazwischen und dazwischen und ... Poetische Hefte und Zyklen 1979-1987. Textem Verlag, 2011, 23 Euro
http://www.wdr3.de/mosaik/details/02.07.2012-06.05-wdr-3-mosaik.html
„Wie eine Welle durch die Stadt“

Der Künstler Heiko Neumeister hat Pflasterklinker fotografiert. Ein Gespräch über zuviel des Roten, schöne und hässliche Steine – ohne über Minimal Art oder den Subjektbegriff zu sprechen.
Herr Neumeister, Sie haben fotografiert, wie in einer deutschen Stadt rote Pflasterklinker verlegt werden, wie man sie von überall kennt. Was ist daran inspirierend?
2010 erhielt ich ein Stipendium des Landes Schleswig-Holstein und konnte im Künstlerhaus Eckernförde arbeiten. Vor dem Haus gab es eine Baustelle. Da wurde die Straße gemacht. Zuerst wurde der Asphalt entfernt, dann die Steine verlegt. Ich habe das etwa drei Monate lang mit dem Fotoapparat begleitet. Mich hat daran interessiert, wie eine Flächenarchitektur entsteht.
Finden Sie die Steine schön?
Manchmal schön, manchmal hässlich. Wenn man genauer hinguckt, sind sie auch gar nicht so gleich, wie man denken mag. Mal sehen sie ein bisschen gelber aus, mal grauer. Das changiert je nach Flammierung. Und dann spielt das Licht auch eine große Rolle. Der Sonnenuntergang schlug schräg darauf, das ergab ein intensives Leuchten.
Es kann aber auch des Roten zu viel sein.
Ja. Wenn die weißen Häuserfassaden rot werden, sogar die Augen der vorbeigehenden Leute, dann ist das, als würde alles mit einer Haut überzogen. Rote Brennnessel – das finde ich denn doch absurd. Aber beim Fotografieren ging es mir nur darum, die Steine ganz neutral zu sehen.
Deutschland ist zugepflastert mit solchen Steinen. War Ihnen das zuvor nicht aufgefallen?
Klar. Ich habe sogar mal welche für meine eigenen Arbeiten benutzt – als Sockel für kleine Betonskulpturen auf einer Wiese. Aber natürlich achte ich mehr darauf, seit ich mich so intensiv damit beschäftigt habe. Es liegen da übrigens noch andere künstlerische Themen als Klinkersteine im Wortsinn auf der Straße: Gullydeckel, Gehwegplatten, Verkehrsleitflächen.
Wie haben die Bauleute es aufgenommen, dass Sie dort fotografierten?
Freundlich. Es waren überhaupt erstaunliche Leute, immer gut gelaunt. Dabei knien sie acht Stunden lang. Ich denke, es hat sie beeindruckt, dass es da eine Parallelität gab: Sie haben mit Millimetersorgfalt die Steine verlegt. Klick, klick, klick – so ging es den ganzen Tag. Und ich habe mit ähnlicher Sorgfalt meine Fotos gemacht. Die Bauleute sind da wochenlang beschäftigt, sie identifizieren sich mit ihrer Aufgabe. Aber wenn die Fläche fertig ist, gehen sie einfach weg. Mir erging es ähnlich. Bei der fertigen Fläche verschwindet aller Zauber. Der Zwischenzustand hat etwas Verzückendes.
Bewegung ist alles, das Ziel ist nichts.
Genau. Ich habe die Werkzeuge fotografiert, die Stapel von Steinen, die schon zur Markierung gelegten Steine, die ersten Muster, die Schlagschnur. Das ist ein perfekt durchlaufendes Flächensystem. Das Muster legt sich in die Fläche hinein wie eine Welle, die durch die Stadt spült und sich nicht mehr aufhalten lässt. Dann ist es auf einmal fertig – und man nimmt es nicht mehr wahr. Eigentlich eine Bizarrerie, überall in Deutschland zu finden.
Das teilt sich auch in Ihrem Buch über Ihr Eckernförder Abenteuer „Selbstbehauptung im Angesicht des Absoluten“ mit. Danke für die Auskünfte!
Aber wir haben noch gar nicht über die Minimal Art gesprochen und Malewitschs „Rotes Quadrat“, auch nicht über den Subjektbegriff. Aber wahrscheinlich ist das gar nicht nötig.
FAZ, 20. 06. 2012 http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/fotos-von-pflastersteinen-wie-eine-welle-durch-die-stadt-11793251.html
V wie Verkrampfung
Für die Entspannung gibt es ganze CD-Sammlungen, Songs, die zur Verkrampfung aufrufen, sind selten, aber auch die gibt es. Die verkrampfte Stimmung ist ironiefrei, und die allgemeine Verkrampfung steigt. Über die seelische, kommunikative und körperliche Verkrampfung hat sich der Wissenschaftspublizist und Künstler Armin Chodzinski Gedanken gemacht.
Armin Chodzinski über sein Buch "Verkrampfung", [13:24]
Buchtipp: Chodzinski, Armin: Kleiner Stimmungsatlas in Einzelbänden - Verkrampfung, Textem Verlag 2011, 71 Seiten, 12 Euro
Radio Bremen, 17. Juni 2012
Zeitschriftenschau

Die 13. Ausgabe von Kultur & Gespenster kommt wieder in altgewohnter Pracht daher. Größter Leckerbissen und der Reproduktionen wegen auch optisch ein Lesevergnügen ist eine Auswahl Briefe, die Adorno in den 60er Jahren mit alten Bekannten und Jugendfreunden, Studenten, Lesern und Rezensenten gewechselt hat.
Da meldet sich eine 92-jährige Pädagogin, die den Professor noch als Knaben gekannt haben will (sie verwechselt ihn allerdings mit seinem Cousin). Da schreibt „ein alter, längst verschollener Freund“ und steuert schon im zweiten Satz auf einen „bösen Schnitzer“ in den Minima Moralia zu, den es „auszumerzen“ gelte. Da erkundigt sich ein Rezensent von Quasi una fantasia nach dem „Bindungscharakter“ der Beiträge und wird von Adorno mit einer die Konstellation der Essays erläuternden Antwort bedacht, die wohl unterblieben wäre, wenn er gewusst hätte, dass sein Briefpartner 1946 in Chur zu zwanzig Jahren Zuchthaus verurteilt worden war, u.a. weil er den Anschluss der Schweiz ans Großdeutsche Reich betrieben haben soll. Und beantwortet werden will auch ein Brief vom März 1968, der mit dem Satz beginnt: „Ihre Einstellung zur Homosexualität, die ich als Homosexueller als die einzig richtige anerkennen muss, ermutigt mich, [mich] mit einer kleinen Bitte an Sie zu wenden.“
Adornos stets um Freundlichkeit bemühte Antwortschreiben (Typoskriptdurchschläge auf Pergamentpapier) sind eine Wonne, auch wegen Formeln wie „Schönsten Dank für Ihren Brief; er hat mich sehr bewegt“ oder „Ich selbst bin nicht, wie Sie anzunehmen scheinen, homosexuell, verspüre auch nicht die leisesten Neigungen nach dieser Richtung.“
Am Erker Nr. 63
„Word-Splatter-Moves“ und entautomatisierte Wahrnehmung

„Stadt unter“, so heißt der neue, postmoderne Roman von Autor und Kulturjournalist Carsten Klook, der Kriminalroman, Meta-Text und Spielwiese in einem zu sein scheint
Von Stella Hoffmann
Künstlerhaus, Klischees, Konstruktionen – Katastrophe?! Oder heißt es doch gleich wieder: Kommando zurück? Carsten Klooks neuester Roman „Stadt unter“ entstand zum Teil während seines Stipendiums im Künstlerhaus Lauenburg/Elbe. Der geneigte Leser sollte sich jedoch nicht gleich von dem ersten Absatz, der wie folgt beginnt: „Grünbraun-graphitgrauer Strom, blau meliert tanzende Flächen, die Kuppen der wellgepappten, weggewellten… wollt ihr ewig wellen, willig wippen… ihr umkräuselnden, umhergekräuselt-daher-gekrault-kommenden, lendenumspülenden Wogen“, abschrecken lassen, sondern etwas Durchhaltevermögen beweisen. Es lohnt sich, die Geschichte des erfolglosen Drehbuchautors Marc, der sich gerade an einer Folge für den neuen „Kommissar Hock“ die Zähne ausbeißt, sowie von dem „Chintzwesen“ Jill, die er in einem Lauenburger Café kennen lernt, bis zum Ende zu verfolgen.
Doch worum geht es dem Autor Carsten Klook überhaupt? Frei nach dem Motto „Nicht überall, wo Liebesgeschichte draufsteht, ist auch wirklich nur Liebesgeschichte drin“ hält er eine ganze Palette von Roman-Genres bereit. Immer wieder nimmt er seine Leser bei der Hand und führt sie behutsam und mit direkten Verweisen unterstützend auf die richtige Spur. Auf den ersten Blick scheint es, als versuche Marc, ein Krimi-Drehbuch zu schreiben. Klook überführt ihn jedoch bei der „Dekonstruktion seines Möchtegernkrimis“. Zuweilen scheinen sich die Stimmen von Autor Carsten Klook und Drehbuchautor Marc sogar zu überlagern. Während Marc Kritik an den „sterbenslangweiligen Fernsehkrimis“ übt, wirkt dies wie ein Unterton zu Klooks Kritik an der aktuellen Medienwelt, die ihren Bildungsauftrag bedenkenlos den verspielten Teletubbies überträgt.
In seinem postmodernen Roman scheinen dem Autor keine Grenzen gesetzt zu sein. Immer wieder verstrickt er sich in neue Wortspiele und Assoziationsketten wie „Till Lauenspiegel“. Oder aber er lässt Marc sich fragen, in welche Richtung er seine Protagonisten wohl „schicken würde. Chicken-Würde McNuggets, dachte Marc im Traum und bekam Hunger“. Klook spielt mit dem Leser, der in den konstruierten und anschließend dekonstruierten Krimi-Klischees seine eigene Erwartungshaltung entdeckt und sich dabei auf die eigenen Füße getreten fühlt. Wer weiß schließlich nicht, dass immer derjenige der Täter ist, den „man am wenigsten dafür hielt“ und dass zu jedem guten Krimi eine rasante Verfolgungsjagd gehört? Rücksichtslos bricht Klook mit den Konventionen, wenn er zwischen „die buntesten und schillerndsten Keramiktiere, […] Teller und Tassen“ völlig unerwartete „Brokatkissenschlacht-Fetzen“ und „Skalps“ setzt. Er bricht jedoch nicht nur mit gängigen Sprachbildern, sondern auch mit Phrasen, und so malte sich Jill ein Bild nicht vor dem inneren Auge, sondern „vor dem inneren Ohr aus“.
Seinen Protagonist Marc lässt er immer mehr in seine eigene Traumwelt abgleiten, sodass im Endeffekt weder er selbst, noch der Leser so ganz genau weiß, was nun der fiktionalen Realität entspricht oder gänzlich dem Reich der Fantasie angehört. Zeitweilig scheinen Marcs Figuren wie Frankensteins Monster zum Leben zu erwachen und versuchen ihrem Erfinder zu schaden, indem sie sein Skript löschen. Durch einen kurzzeitigen Perspektivenwechsel, in dem Klook von einer Ich-Erzählung zu einer neutralen Erzählsituation springt, wird Marc vom Subjekt zum Objekt seiner Erzählung. In einer anderen Szene beschreibt Marc den Verlauf einer typischen Tatort-Szene, und somit werden sowohl er als auch der Leser zu einem außenstehenden Betrachter.
Doch was bezweckt Carsten Klook mit seinem neuen Roman? Möchte er die Geduld und das Wohlwollen seiner Leser testen? Immer wieder reißt er sie durch verwirrende Sätze aus ihrem Lesefluss und scheint diesen durch seine Kommentare und direkten Hinweise zu leiten oder gar zu manipulieren. Selbst vor dem Layout macht der Autor keinen Halt und tobt sich in ihm aus wie auf einer Spielwiese.
Er setzt verwirrende Fußnoten, die an die Labyrinth-Struktur des Romans „House of leaves“ von Mark Z. Danielewski erinnern, und die Kapitelüberschriften rutschen gegen Ende des Textes von der Kopf- in die Fußzeile. Auch diese Modifizierung des Layouts dient dem Bruch mit den Erwartungen des Lesers. Jorge Bucay sagte einmal: „Kindern erzählt man Märchen zum Einschlafen – Erwachsenen, damit sie aufwachen!“ Der Leser wird durch diese Neuerung im Aufbau wachgerüttelt. Am Ende wird er jedoch feststellen, dass Klook bis zum Ende seiner (Meta-)Erzählung seinem Prinzip treu geblieben ist. Doch was bewirken seine und Marcs so genannten Word-Splatter-Moves? Wozu dienen sie?
Viktor Šklovskij bezeichnete Kunst als ein Verfahren zur Entautomatisierung der Wahrnehmung. Ob Carsten Klook mit seinem Roman diesen Zweck verfolgte, können wir nicht wissen. Dennoch kann der immer wieder aufschreckende und aufgeschreckte Leser konstatieren, dass Klook dies auf jeden Fall gelungen ist, wenn es ihm denn um diese besondere Form der Aufmerksamkeit gegangen sein sollte. Kurz: Carsten Klooks Roman „Stadt unter“ ist ein amüsanter Genuss für Freunde des raffinierten Wortspiels in jeglicher Façon sowie der experimentellen Prosa.
Amorbach retten, wenn schon nicht die Welt

Leserbriefe an Adorno
Adornos Präsenz in den frühen sechziger Jahren - nicht nur an der Universität und in Buchpublikationen, sondern auch im Radio und gelegentlich im Fernsehen - machte ihn zu einer Figur, von der sich mancher einen philosophisch informierten Rat auch in privaten Dingen versprach. Philipp Felsch und Martin Mittelmeier machen auf die Vielzahl von unverlangt eingesandten Briefen aufmerksam, die sich im Nachlass des Philosophen finden (",Ich war ehrlich überrascht und erschrocken, wie umfangreich Sie geantwortet haben'. Theodor W. Adorno korrespondiert mit seinen Lesern", in: Kultur und Gespenster, Band 13, 2012). Der Grund dafür war, dass Adornos Werk die Grenzen geistiger Arbeitsteilung überschritt und Anweisungen zum Musikhören ebenso liefern konnte wie, in den "Minima Moralia", die Analyse konkreter Lebenslagen.
Gerade zu diesem Buch meldete sich Roland F. Jaeger, ein Jugendbekannter, der sich an Übersetzungen von Paul Claudel versucht hatte, die ungedruckt blieben. Dem "lieben Teddy" kreidet er dort gleich in den ersten Sätzen einen "bösen Schnitzer" an, ohne sich mit dem Werk ansonsten auseinanderzusetzen; nur erging der Rat an Adorno, die Bekenntnisse des Augustinus "als Ausgleichsgymnastik" zu lesen. Bei dem "Schnitzer" handelte es sich darum: "Ein ,Lichtjahr' ist kein Zeit-, sondern ein Längenmaß - Unkenntnis in den besprochenen Realia macht sich selbst bei einem Hegelianer nicht gut." Der Fehler wurde in den folgenden Auflagen korrigiert. Im Antwortbrief vom 9. September 1963 bedankte sich Adorno für den Hinweis nicht ohne einige Verdrießlichkeit: "Mir kommt das etwa so vor, wie wenn jemand, der ein Konzert hört, in dem so allerhand musiziert wird, nichts wahrnimmt, als dass ein Ton des Klaviers verstimmt sei. Ich fürchte, diese Verhaltensweise war Dir nie ganz fremd." Es gibt keine richtigen Leserbriefe im Falschen.
Im Übrigen gibt es neben Kuriosa auch ernsthafte und zum Teil berührende Leseranfragen. Rudolph Bauer, ein Hörer der Vorlesungen, fragt im Herbst 1965 im Sinne der 11. Feuerbach-These von Marx nach dem Verhältnis der Philosophie zur Veränderung der Welt und merkt an: "Ich komme nicht drum rum, Marx etwas differenzierter zu nehmen." Das Schreiben blieb unbeantwortet, aber eine Reaktion kam trotzdem, indem Adorno dann eine gesamte Vorlesung den Fragen Bauers widmete: "Meine Damen und Herren, ich habe aus Ihren Reihen einen mich außerordentlich bewegenden Brief erhalten . . ." Dann folgte ein Plädoyer gegen den "Praktizismus".
Das gleiche Problem, in die private Lebensführung gespiegelt, ergab sich nach dem Brief einer jungen Dame, die die "totale Negativität" erkannt zu haben glaubte und in eine existentielle Krise hineinsteuerte. Ihr konnte er 1966 durch Zureden helfen: "Lassen Sie mich heute, ohne dass Sie es als väterliches Auf-die-Schulter-Klopfen missverstehen, nur noch hinzufügen, dass ich Ihnen abraten möchte, in einer Art von Kurzschluss aus Gedanken, für die ich mehr oder weniger verantwortlich bin, allzu rasch reale Konsequenzen zu ziehen." Solche Reservationen wurden, je näher das Jahr 1968 rückte, zu Adornos Hauptgestus.
Sein Brief an die Stadtverwaltung von Amorbach atmet dagegen eichendorffschen Geist, der gegen die planerischen "Verwüstungen" der Moderne aufgeboten wird. Die Umgehungsstraße B 47, gegen die Adorno sich aussprach, wurde dennoch gebaut.
L.J., 09.05.2012, F.A.Z., Geisteswissenschaften
Zeitschriftenlese

Den geheimnisvollen Titel Kultur & Gespenster trägt ein opulent aufgemachtes, geistig anregendes Magazin, das kürzlich zum 13. Mal, 300 Seiten stark, in Hamburg erschienen ist. Die Redaktion interessiert sich für philosophische und soziologische Fragen, widmet sich der Literatur, der Musik, der bildenden Kunst und der Fotografie.
Pierangelo Maset und Daniela Steinert, ein Dozent und eine Studentin, beide mit hochschulpolitischen Erfahrungen, beklagen die „wahnwitzige Lage“ an den deutschen Universitäten, also die Ökonomisierung der Bildung und all die technokratischen Reformen, die uns die „unternehmerische Hochschule“ beschert haben - auch eine Folge der radikalen Forderungen von 1968, denn: „Der Kapitalismus hat die Wünsche nach Authentizität und Selbstverwirklichung sowie nach Leistungsgerechtigkeit und flachen Hierarchien aufgesogen.“ Auch mit den Studenten ist nicht mehr viel los, sie sind angepasst, haben eigenständiges Denken nicht gelernt.
So jammern die beiden Autoren seitenlang auf hohem Niveau. Tenor: Alles wird immer schlimmer durch Zentralisierung, Bürokratisierung, Controlling, die böse EU. Und weit und breit keine Bereitschaft zum Widerstand. Am Ende retten sich die Kritiker in die mehr als vage Hoffnung, es könnten sich „die wenigen Beherzten“, dem „Geist“ der Universität verpflichtet, „zu selbst organisierten Neugründungen“ aufraffen.
Dass Theodor W. Adorno ein einfühlsamer Briefpartner war, wusste ich schon vorher. Denn in Alexander Kluges Fünftem Buch, das in diesem Jahr erschienen ist, sind zwei erstaunliche, sehr persönliche Briefe des „alten Teddie“ an den „lieben Axel“ von 1967 abgedruckt. Kultur & Gespenster zeigt nun, wie Adorno in eben diesen 60er Jahren, auf dem Höhepunkt seiner öffentlichen Wirkung, mit einigen seiner Leser korrespondiert hat. In Faksimile sind dort, geistreich kommentiert von Philipp Felsch und Martin Mittelmeier, acht Briefe an Adorno sowie dessen Antworten zu lesen. Auch wenn ihm manche Zuschrift lästig gewesen sein mag, stets antwortet der berühmte Philosoph schnell und höflich, geradezu pflichtbewusst, etwa einer sehr alten Dame, die ihn an seine Knabenzeit erinnert hat, dabei vorsichtig Missverständnisse korrigierend. Ein längst verschollener Schulkamerad, der sich dem großen Mann gegenüber ein wenig aufspielt, wird vorwurfsvoll zurechtgewiesen, doch umgehend wird ihm auch, was rührend anmutet, ein Gesprächsangebot gemacht. Und eine ob der „Erkenntnis der totalen Negativität“ verzweifelte Studentin warnt Adorno vor Kurzschlusshandlungen, vor „Gedanken, für die ich mehr oder minder verantwortlich bin“, und schlägt zugleich ein Zusammentreffen vor.
Um 1965 tauchen im Auditorium die ersten kritischen Marx-Leser auf, Vorboten der Studentenrevolte. Einer von ihnen, Rudolph Bauer (was mag aus ihm geworden sein?), wendet sich an den Professor und spricht, ausgehend von Marx´ berühmter 11. Feuerbach-These, das prekäre Verhältnis von Theorie und Praxis an. Entgegen seiner Gewohnheit hat ihm Adorno keinen Antwortbrief geschickt, sondern seiner Nachfrage die komplette folgende Vorlesungsstunde gewidmet.
Michael Buselmeier, Saarländischer Rundfunk, 15. 5. 2012
Welche Sprache spricht man im Paradies?

Schon der Stauferkaiser Friedrich II. wollte es wissen. Wie haben die Menschen nur gesprochen, vor der allgemeinen Sprachverwirrung, die dem Turmbau zu Babel folgte? Um das herauszufinden, soll er befohlen haben, einige Neugeborene von jeglichem Sprachkontakt zu isolieren. Die Babys wurden zwar königlich gepflegt und versorgt, aber niemand durfte ein Wort an sie richten oder in ihrer Umgebung sprechen.
Das Experiment, das die menschliche „Ursprache“ enthüllen sollte, scheiterte: Nach einiger Zeit starben die Kinder, ohne je auch nur ein Wort gesprochen zu haben. Ein hoher Preis, für die Erkenntnis, dass Sprache kein Nebenprodukt des Menschen, sondern grundlegender Teil seiner Existenz ist, eine Realität derselben Notwendigkeit wie Nahrung oder Luft. Nichtsdestotrotz merken wir immer wieder, dass Sprechen an sich oft nicht ausreicht, um uns anderen mitzuteilen.
Der Mensch ist ein gewissermaßen ‚gebrochenes’ Wesen. Hin- und hergerissen zwischen einer Vorstellung und ihrem tatsächlichen Ausdruck, muss er jeden Tag aufs Neue versuchen, sich in angemessener Weise verständlich zu machen. Zu groß ist die Vielzahl an Bedeutungen, die eine einzige Benennung eines Dings mit sich bringt. Zu oft fehlen uns die rechten Worte. Zu sehr abgegriffen erscheinen meistens die Begriffe.
Sprechen wie im Paradies
„Paradiessprache“ heißt das Projekt von Sabine Weingartner, die es sowohl konzipiert und initiiert als auch geleitet hat. Hinter dem Titel steckt die paradiesische Vorstellung der Rückkehr zu einer Sprache, die es wieder ermöglichen soll, das wahre Wesen der Dinge zu erfahren. Es ist ein utopischer Entwurf, jedoch mit hohem Inspirationspotential. Wie sich der grundsätzliche Zweifel am sprachlichen Ausdrucksvermögen zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts zu einer schier unerschöpflichen Quelle von Kreativität gemausert hatte, wurde auch hier die Sprache zum Antrieb für künstlerisches Schaffen.
Wo Sprache ihr Ende findet, fängt Bildlichkeit an, doch auch diese garantiert kein echtes Verstehen. Zusammen mit jungen Künstlern und Literaturwissenschaftlern begab sich die 28-jährige Münchnerin auf die Suche: „Der sprachphilosophische Begriff der „Paradiessprache“ sollte im Zentrum der Beschäftigung stehen, dem man sich als eine Art Forschergruppe durch Lektüre literarischer und wissenschaftlicher Texte und Diskussionen annäherte. Auch die Handlungstheorie der beteiligten Künstler sollte vor diesem Hintergrund beleuchtet werden.“
Weingartner selbst hat Kunstgeschichte und Literaturwissenschaft studiert und bereits interdisziplinär und zum Begriff „Paradiessprache“ gearbeitet. Sie betont: „Bildende Kunst und Literatur sind ja beides freie Künste – so interessiert es mich, Gemeinsamkeiten in der Problemstellung und Methodik sowohl auf Rezipienten- als auch auf Produzentenseite herauszustellen.“ Außerdem konnte die Zusammenarbeit in der Gruppe von der Textsicherheit und –Kenntnis der Germanisten bzw. Komparatisten profitieren.
Grenzaufweichungen
Das Projekt ermöglichte den Studenten, als Forschergruppe und Produzentengemeinschaft gleichermaßen zu arbeiten: „Die Grenzen zwischen bildenden Künstlern und Wissenschaftlern sollten aufgeweicht und nach Gemeinsamkeiten in der Methodik gesucht werden.“ Weingartner beobachtete dabei, dass dieser Ansatz für die Studenten eine völlig neue Erfahrung war: "Die ‚Fronten’ zwischen Kunst und Wissenschaft waren anfangs doch offensichtlich – man hat sich schon gegenseitig beäugt, das hat mich überrascht." Die meisten Literaturwissenschaftler hätten noch nie einen Fuß in die Kunstakademie gesetzt oder andersherum. So sei die Konstellation als solche immer wieder intensiv diskutiert worden. "Die Situation", so Weingartner, "war demnach für beide Seiten ungewöhnlicher als ich von meiner Perspektive aus vermutet hatte."
Doch das Ergebnis kann sich sehen lassen. Aus dem Projekt entstand ein Buch. Ein Ziel wurde somit schon mal erreicht, sagt Sabine Weingartner: „In dem Buch sind sehr unterschiedliche Beiträge vereint, die jedoch gemeinsam haben, dass sie sehr frei und assoziativ mit dem Thema umgehen. Es sind beinahe ausschließlich künstlerische Beiträge entstanden: Gedichte, Erzählungen, eine Tragikomödie...“
Die Sehnsucht nach Nähe
Es ist in der Tat ein buntes, gleichzeitig unglaublich trauriges Buch. Die darin veröffentlichten Werke der jungen Künstler offenbaren nämlich, dass der Mensch nach wie vor im Chaos lebt, trotz der neuen Bequemlichkeiten, des Überflusses, all der technischen Möglichkeiten und des schönen glitzernden Scheins. Diese Zutaten unseres Lebens sind eigentlich leblos; und streifen wir mit einem hastigen Blick das wahre Wesen unseres Seins, sehen wir, dass wir unbemerkt ein direktes Gegenüber, ja, physische Nähe verloren haben, die aber wichtigste Voraussetzung für echtes Verstehen ist.
Gelebtes Verstehen zeigt sich in Beziehungen. Die Versuchskinder von Kaiser Friedrich II. sind an ihrer lautlosen Einsamkeit zugrunde gegangen. Die Künstler des Buches machen dem Betrachter klar, dass auch heute der Mensch – ironischerweise gerade wegen Kanalschwemme und Dauerberieselung – in eine ebenartige Einsamkeit zu fallen droht. Dialoge über Lautsprecher und Übersetzer verkommen hier beispielsweise zu starren Floskeln, Bildlichkeiten werden immer neu missverstanden und hübsch angeordnete Texte reduzieren sich sichtbar auf ein bloßes ‚Bild’, eine Form.
Das tatsächliche Verständnis der Dinge bleibt somit verwehrt, jeder steht mit seiner nicht mitteilbaren Interpretation allein. Wo im Nachdenken über das disparate Wesen der Sprache dieses im besten Fall geglättet werden sollte, wird das verzweifelt disparate Wesen des Menschen enthüllt. Der einzige Anker im nur oberflächlich geordneten Chaos: das Verstummen. Der letzte Eintrag des Buches ist ein ‚Gedicht’, eine Aneinanderreihung einzelner Zahlen zwischen 2 und 8. Das einzige, was sie zusammenhält, ist ein Gedankenstrich.
Sabine Weingartner (Hrsg.): Paradiessprache. Textem Verlag Hamburg 2012.
Das Wunder in der Sprechstunde

Kritische Theorie im Praxistest: Was Theodor W. Adorno seinen Lesern antwortete
Es war im Sommer 1966, als das Fräulein, deren Namen wir nicht kennen, keinen anderen Ausweg mehr wusste und ihm schrieb. Ihm, der ihr Leben verdunkelt hatte, beziehungsweise, der ihr die Augen geöffnet hatte für die Dunkelheit der Welt, in der wir alle leben. Im Sommersemester des Jahres zuvor hatte sie in Frankfurt seine Vorlesung über Metaphysik gehört und war erschüttert über die Unmöglichkeit der Flucht aus dieser falschen Welt, der Welt nach Auschwitz. Erschüttert auch über die Gleichgültigkeit, mit der ihre Kommilitonen diesen Bannspruch über die Gegenwart aufnahmen und weiterlebten, einfach so. Sie konnte es nicht, las alle Schriften des Professors und erkannte "die totale Negativität" in allem. Ein Leben ist entzweigegangen durch die Schriften dieses Mannes, sie hat den Kontakt abgebrochen zu allen Freunden, die weiter so dahinleben, als wäre nichts geschehen, und zu den anderen, die Trost suchen in der Religion oder resignierendem Ästhetizismus. Und jetzt schreibt sie an ihn: "Ich finde niemanden, der mir irgendwie helfen könnte." Außer ihm, Theodor Wiesengrund Adorno, dem Autor der "Minima Moralia", der "Dialektik der Aufklärung", der jetzt, im Sommer 1966, dem Höhepunkt seines Ruhmes entgegenstrebt.
Er ist der Monopolist des kritischen Denkens in der frühen Bundesrepublik, er bespielt das Massenmedium Radio nach Belieben, Horkheimers und sein Diktum "Die vollends aufgeklärte Welt strahlt im Zeichen triumphalen Unheils" ist der Generalbass der Epoche. Er ist das geistige Zentrum der kritischen Welt, das Medium der Negativität. In welchem Ausmaß er bereit war, diese Rolle bis in kleine Alltagsfragen hinein zu spielen, das kann man jetzt erst so richtig erahnen: Die Zeitschrift "Kultur und Gespenster" veröffentlicht in ihrer aktuellen Ausgabe eine kleine Auswahl von Briefen, die Adornos Leser, ferne Freunde und Studenten an den Meister schrieben, und vor allem auch seine Antworten darauf. Es ist eine Art Praxistest der Kritischen Theorie. Die Finder, Herausgeber und Kommentierer dieser Briefe, Philipp Felsch, Professor an der Humboldt-Universität, und Martin Mittelmeier, Lektor beim Luchterhand-Verlag, sagen, es gebe im Archiv der Akademie der Künste, wo sie diese Briefe fanden, weit mehr als hundert solcher Kurzbriefwechsel Adornos mit hoffnungsfrohen Ratsuchern. In der aktuellen Nummer der Zeitschrift haben sie nur eine erste Auswahl veröffentlicht. Aber schon diese ist phänomenal.
Dem verzweifelten Fräulein zum Beispiel antwortet er sofort, offenbar das Schlimmste befürchtend, ihr Brief habe ihn sehr bewegt, er beschwört sie geradezu und rät dringend davon ab, "in einer Art von Kurzschluß aus Gedanken, für die ich mehr oder minder verantwortlich bin, allzu rasch reale Konsequenzen zu ziehen". Und er fügt an: "Der Weg vom Denken zur sogenannten Praxis ist viel verschlungener, als man es im allgemeinen heute sich vorstellt." Ein Philosoph steht erschüttert im Wirkungsfeld seiner eigenen Worte und versucht, den Faden zwischen Theorie und Praxis verzweifelt zu kappen. Selbstmord also ist unbedingt keine Lösung, wie dunkel er die Welt auch beschrieben habe, und das Fräulein möge am besten umgehend, sobald er aus den Ferien zurück sei, in seine Sprechstunde kommen. Sie kommt - und wird geheilt. Im nächsten Brief spricht sie von einem "Wunder", das sie erlebt habe, und dass sie erst jetzt verstanden habe, dass sie nicht Trost gesucht habe bei ihm, "sondern Solidarität in der Trostlosigkeit".
Schon ein Jahr zuvor hatte er sich vor einem Enthusiasten der Praxis mühsam schützen müssen. Der Student Rudolph Bauer zeigt sich verwundert darüber, dass Adorno in seiner Vorlesung über "Negative Dialektik" die Marxsche Feuerbachthese, nach der es in der Philosophie darauf ankomme, die Welt zu verändern, als "veraltet" zurückgewiesen habe. Der Student bemüht sich freundlich, Adorno darauf hinzuweisen, dass dies nicht im Sinne seiner eigenen Philosophie sein könne: "Vielmehr will ich meinen, daß ihre kritische Intention einer Veränderung der Welt und ihrer Verhältnisse die Sporen gibt." Und fügt, wie nebenbei, die Fragen aller Fragen an: "Zielen Ihre Bestrebungen auf eine Veränderung der Welt ab?"
In diesem Brief stecken erste Spuren jenes Sprengstoffs, der den Meister der Kritischen Theorie wenige Jahre später, von den bloßen Brüsten revolutionärer Studentinnen verstört, aus dem Hörsaal treiben wird. Adorno muss geahnt haben, welche Energie sich in diesem Brief andeutete. Er ließ es nicht bei einem Antwortbrief bewenden. Seine Vorlesung am 23. November 1965 beginnt er mit den Worten: "Ich habe aus Ihren Reihen einen mich außerordentlich bewegenden Brief erhalten", um anderthalb Stunden lang wortreich das drohende Unheil einer überstürzten Transformation von Theorie in weltverändernde Praxis zu beschwören. Und Marx schließlich kurzerhand auf den Kopf zu stellen: "Die Welt ward wahrscheinlich auch deswegen nicht verändert, weil sie zu wenig interpretiert worden ist." Den revolutionären Mut der theoriebewaffneten Studenten vermochte er durch solche dialektischen Volten nicht mehr lange einzudämmen. Adorno ahnte vielleicht schon, dass aus seinen Worten eines Tages Taten werden würden.
Die Briefe an Adorno, die wir jetzt lesen dürfen, sind großartige Dokumente mutiger Menschen, die sich entschlossen haben, jene Linie zu entdecken, welche die Unheilsdiagnose mit ihrer Lebenswirklichkeit verbindet. Adorno antwortete stoisch, fleißig, unermüdlich. "Ich war ehrlich überrascht und erschrocken, wie umfangreich Sie geantwortet haben", schreibt ihm ein Leser zurück.
Besonders bewegend ist der Brief eines achtzehnjährigen Homosexuellen aus Wien, der schreibt, seine Veranlagung wäre an sich kein Problem für ihn, "wäre ich nicht mit einer unwissenden, haßerfüllten, tyrannischen, kein ,anderssein' duldenden Welt konfrontiert". Vermutlich hatte er Adornos Artikel "Sexualtabus und Strafrecht heute" gelesen, der ihn ermutigt hatte, dem Professor zu schreiben. Er fleht Adorno an: "Bitte schreiben Sie mir", "Ich bin jung und verzweifelt, aber ich will nicht den Glauben an mich verlieren . . .", und ob Adorno nicht vielleicht eine "homosexuelle Zeitschrift kenne", in der er über ähnliche Schicksale lesen könne. Adornos Antwort ist beschämend abwehrend. Er müsse ihn missverstanden haben, er sei keineswegs homosexuell (das hatte der Briefschreiber gar nicht behauptet) und "verspüre nicht die leisesten Neigungen in dieser Richtung". Und eine solche Zeitschrift könne er selbstverständlich auch nicht empfehlen, denn solche Blätter seien ohnehin "nur Versuche zur kommerziellen Ausbeutung irgendwelcher Triebrichtungen". Auch hier, man muss es sagen, versagt die Kritische Theorie im Praxistest.
Einen glücklichen Ausgang immerhin gab es noch. Ein Brief aus Amorbach hat ihn erreicht, der Ort im Odenwald, in dem die Wiesengrunds Urlaub machten und den er einmal "den einzigen Ort auf diesem fragwürdigen Planeten" nannte, "in dem ich im Grunde mich zu Hause fühle". Ein unglaublich rührender Brief von einer frühen Freundin aus den Urzeiten vor dem Krieg. Ein Brief aus deutschem Idyll, das bedroht ist, so schreibt sie ihm, vom Bau einer Umgehungsstraße, und ob er, der berühmte Mann, nicht helfen könne. Da lässt Adorno sich nicht zweimal bitten. Noch im selben Monat schreibt er an die Stadtverwaltung und beschwört die Herren, der drohenden "Verwüstung", dem "Unheil", Einhalt zu gebieten. Er fleht geradezu, "alles zu unterlassen, was den in seiner Weise einzigartigen Platz häßlich machen könnte". Mit Erfolg. Die Straße wurde Jahre später zwar gebaut, aber mit anderer Streckenführung. Ein kleiner Sieg der Theorie. Ein Sieg der Schönheit. Für einen Moment.
Volker Weidermann, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 15. April 2012
Antihelden und Alltagsritter

Der schöne Mann – Das Magazin ist eines von sechs internationalen studentischen Projekten, die am 8. Mai 2012 vom Art Directors Club mit Gold ausgezeichnet werden. Ausgedacht hat sich das Heft der Studiengang Integriertes Design der Hochschule für Künste in Bremen. Fotos, Texte, Gestaltung und selbst die gezeigten Outfits entstanden in Eigenregie mithilfe des Fotografen Joachim Baldauf und der Designerin Tania Prill. Das Magazin, das im Textem Verlag erschien, ist ausverkauft. Als PDF kann man es aber noch kostenlos von der Verlags-Website laden.
Zeitschriftenlese

Zu den großen Unverstandenen der modernen Poesie zählt auch der häretische Dichter und Mystiker Hugo Ball, der zwar als Wegbereiter des Dadaismus und Galionsfigur der literarischen Avantgardebewegungen zu einiger Berühmtheit gelangte, dessen Spätwerk aber bis heute haarsträubenden Fehldeutungen ausgesetzt ist. Da sich Hugo Ball nach seiner dadaistischen Periode wieder dem Katholizismus zuwandte und in seinen späten Schriften eine Apologetik der Askese und der Gottergebenheit entwickelte, gilt er den aufgeklärten Zeitgenossen von heute als religiöser Eskapist. In einem philosophisch weit ausgreifenden und direkt in die Gegenwart weisenden Essay versucht nun der Theologe Johannes Hoff Hugo Balls späten Aufsatz „Der Künstler und die Zeitkrankheit“ aus dem Jahr 1926 als „wegweisende Intervention in eine anhaltende Krisenkonstellation“ zu lesen. Dieser Aufsatz findet sich in der überaus lesenswerten und wunderbar unberechenbaren Zeitschrift „Kultur & Gespenster“, die in ihrer aktuellen Nummer 13 einige großartige Beiträge zu bieten hat. Johannes Hoff unternimmt es hier, Hugo Balls Zeitdiagnose von 1926 mit Begrifflichkeiten der Gegenwartsphilosophie aufzurüsten. Dabei würde es genügen, Hugo Balls eigener Denkbewegung zu folgen. Hat der ketzerische Mystiker Ball in seiner Analyse der „Zeitkrankheit“ doch eine verblüffende Hierarchie entworfen: Unten steht bei ihm der Bürger, oben der „Exorzist“, in der Mitte aber, als Vermittler, der Künstler, den Ball auch „Psychiker“ nennt. Dieser Hierarchie-Gedanke geht auf einen Autor des Mittelalters zurück, den vermutlich syrischen Philosophen Dionysius Areopagita, der zu Beginn des 6. Jahrhunderts lebte. Während er in seiner Dada-Zeit den alle Sinne mobilisierenden Künstler zum Idealtyp erklärte, sieht der späte Hugo Ball im „Exorzisten“, also im Teufelsaustreiber die Persönlichkeit, die zum „immer schärferen Erfassen des Substanziellen“ befähigt ist.
Ein ebenso inspirierter Beitrag in „Kultur & Gespenster“ widmet sich dem ambitioniertesten Experimentallabor für die Gegenwartsliteratur, das vor einem halben Jahrhundert eröffnet wurde. „Die Begriffsbildung der Sprache hat mit der technischen Entwicklung nicht Schritt gehalten“: Mit solchen Thesen bereitete der unermüdliche Projektemacher Walter Höllerer 1959 die Gründung einer experimentierfreudigen Institution zur Modernisierung der Literatur vor. Im August 1961 startete dann die Zeitschrift „Sprache im technischen Zeitalter“, die sich die experimentelle Erforschung der Literatur unter den veränderten technologischen Bedingungen zur Aufgabe gemacht hatte. 1963 folgte dann die Gründung des „Literarischen Colloquiums Berlin“, des Prototyps aller Schreibinstitute in der Bundesrepublik. Till Greite rekonstruiert nun in „Kultur & Gespenster“ die Anfangsjahre dieser Berliner „Agentur des Kreativen“, die ganz im Zeichen der ästhetischen Grundlagenforschung zur Materialität der Sprache stand. Der Sprachphilosoph Max Bense räsonierte damals über „die Programmierung des Schönen“, Höllerer selbst initiierte akustische Sprach-Dokumentationen auf Tonbändern und Schallplatten. Es ist hier verblüffend zu lesen, in welcher Weise die klassische Autorfunktion in Frage gestellt wurde – etwa durch die Animierung eines kollektiv verfassten Gruppenromans, der das isolierte Autor-Ich in einen offenen Arbeitsprozess mit Kollegen stellen sollte. Ein Vorgang, der heute, im Zeitalter forcierter Individualisierung, kaum noch denkbar scheint.
Dass sich Walter Höllerers Gründungsidee bis heute ihre Frische bewahrt hat, zeigt sein programmatischer Aufsatz aus dem Jahr 1961, der im Jubiläumsheft 200 der immer noch sehr lebendigen Zeitschrift „Sprache im technischen Zeitalter“ nachzulesen ist. Höllerer erörtert hier die literarischen und wissenschaftlichen Möglichkeiten, wie der universellen „Erstarrung der Sprache“ zu entkommen sei.
Michael Braun, Zeitschriftenlese, Saarländische Rundfunk April 2012
Triebrichtung und Adornos Fanpost
„Kultur & Gespenster“ fungiert als intellektueller Rettungsdienst. Der Titel „Stabile Seitenlage“ ist kein Hinweis auf lebensrettende Maßnahmen, sondern auf Ausreißer intellektueller Art.
Die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Kultur & Gespenster trägt den Titel „Stabile Seitenlage“, und wenn das Assoziationen mit einer Publikation des Rettungsdienstes weckt, dann ist das nicht verkehrt. Nur liegt das Interesse der vom Hamburger Textem Verlag herausgegebenen Zeitschrift nicht auf Autobahnen. Sie selbst bezeichnete sich einmal als „Katalog gegenwärtiger ästhetischer Praxis und Theorie“. Wenn es also hier um lebensrettende Maßnahmen nach Unfällen geht, müssen damit Ausreißer intellektueller Art gemeint sein.
Zum Beispiel die „broken-windows-theory“. Sie besagt, dass, wo Graffiti Straßen säumen, wo Kaugummis kleben oder Müll neben der Tonne liegt, eine höhere Kriminalität herrscht. In einem Gespräch erörtern Joachim Häfele und Marie Luise Birkholz den Einfluss dieser Theorie auf die gegenwärtige Stadtentwicklung.
Mittlerweile sei sie zum Leitkonzept der Stadtentwicklung unter dem Paradigma der Kontrolle avanciert. Monochrome Fassaden und geschlossene Flächen seien folgerichtig die dominanten Merkmale heutiger Architektur-Regime. Allein: In ihrer Sterilität provozierten sie erst den Eindruck von Unordnung. Da mutiert alles zu Unkraut, selbst der „Risikofaktor Mensch“. Dass der Sterilitätswahn bis in deutsche Wohnzimmer gelangt sei, sieht Birkholz darin bestätig, dass der Verbrauch klinischer Reinigungsmittel in Privathaushalten zunehme.
Es ist eine paradoxe Situation: Während überall Abweichung gefordert wird – und sei’s nur der Iro im Bewerbungsgespräch – scheint die Toleranz gegenüber Differenz zu schwinden. Zumindest aber ist sie im Neoliberalismus vollkommen neutralisiert und lässt sich einspeisen in ökonomische Verwertungszusammenhänge. Pierangelo Maset und Daniela Steinert von der Leuphana-Universität Lüneburg liefern in dieser Hinsicht eine längst überfällige Sprachkritik der „unternehmerischen Universität“. Kreativität, Selbstverwirklichung, Freiheit – sie nennen es „Wording“, in dem die Ausbeutungsimperative der neoliberalen Leistungskultur gründen. Abweichung, unbedingt auch kritisch sein, nur zu, aber bitte nur, wenn sie direkt umgemünzt werden kann und die Universität als Marke, zu der sie im „akademischen Kapitalismus“ (Richard Münch) gerinnt, zum Leuchten bringt.
Neben ihrem Engagement in Sachen Institutionskritik kümmert sich die Zeitschrift Kultur & Gespenster auch um die Pflege von Denkmälern der kritischen Tradition. Philipp Felsch und Martin Mittelmeier kommentieren einen Briefwechsel zwischen Theodor W. Adorno und seinen Lesern. Mit archäologischem Gespür versuchen sie die Figur des universellen Intellektuellen freizulegen, die in der Lawine der subjektkritischen Attacken des französischen Poststrukturalismus spätestens in den 70er Jahren verschütt ging. Zu Tage fördern sie einen Adorno, der sich umgänglich zeigt.
Egal ob es um die Verhinderung eines Straßenbaus in Amorbach im Odenwald oder um einen ratsuchenden homosexuellen Studenten geht, der Hinweise auf eine Homosexuellenzeitschrift bei Adorno erbittet. Während Adornos Engagement sich ungebremst gegen den Straßenbau richtet, der die „Amorbacher Kulturlandschaft aufs empfindlichste verletzen würde“, fällt die Antwort an den Studenten verhaltener aus. Er kommentierte: homosexuelle Zeitschriften sind nur „kommerzielle Ausbeutung irgendwelcher Triebrichtungen“. Das sind überraschende Briefe, die hier in Faksimile vorliegen.
Apropos intellektuelle Ausreißer: Dass der Job dieser Zeitschrift als intellektueller Rettungsdienst zermürbend ist wie beim echten Notdienst, muss wohl nicht betont werden. Wie lässig diese Zeitschrift das trotzdem macht und dabei schön aussieht und unverkrampft ist, davon kann man sich auch in der aktuellen Ausgabe ein Bild machen.
taz, Philipp Goll, 10. April 2012
Kurz & Knapp

Stefan Ripplinger: B - Bildzweifel. Eine Einzelstimmung - Als kleinen Stimmungsatlas in Einzelbänden bezeichnet der Textem-Verlag seine Reihe von A wie "Angst" oder wie "Albernheiten" bis V wie "Verkrampfung". Dazwischen liegen "Bildzweifel" oder "Modernität". Form der Texte ist der Essay, das Format für jede Jackentasche geeignet, das Ziel die heitere Erkenntnis und die Motivation, dass "das Schreckensregime des fröhlichen Oberflächenwissens Gegenwehr" herausfordert.
"Bevor Bilder zweifelhaft werden, werden sie lästig", eröffnet Stefan Ripplinger seinen Band. Und dass sie lästig werden, setzt voraus, dass sie einen Wert haben. Den ersten einigermaßen gesicherten Fall einer "offiziellen Bild-Verwerfung" datiert er in die Regierungszeit des Königs Amenophis IV. (1377-1358 v.u.Z.). Der wollte einen neuen Gott, aber ein Kampf um Götter ist immer auch - bis heute - ein Kampf um Name und Bild, denn Bilder hüten die Macht des Abgebildeten. Doch nicht nur das Neue ist eine Bedrohung, auch die Masse ist es... Diese kleine Reihe bringt sofort in Stimmung, das eigene Bild von der Welt zu schärfen mit Büchern, die sich von der Masse abheben.
jaf, Leipziger-Volkszeitung, 17.03.2012
"Wir fühlen uns eher albern"
Verleger Gustav Mechlenburg
Der Textem-Verlag schillert zwischen Kultur, Gespenstern und schönen Männern. Geld ist mit der Unternehmung bislang nicht zu verdienen, aber Renommee.
Interview: Friederike Gräff
"Man braucht all das nicht, was wir machen. Es gibt keine Notwendigkeit, es zu besitzen oder zu lesen": Gustav Mechlenburg.
taz: Herr Mechlenburg, Sie sehen müde aus.
Gustav Mechlenburg: Wir haben immer irgendetwas zu feiern.
Was war es gestern?
Eigentlich nur Schnitzelessen im „Vienna“, aber tatsächlich haben wir ein bisschen gefeiert, weil Volker Renner sein Buch fertig hat, einen Bildband zu Steven Shaw. Shaw war Fotograf und hat eine legendäre Tour durch Amerika gemacht und Renner ist ihm hinterhergefahren und hat die selben Orte nachfotografiert.
Das wird ein Textem-Buch? Man sagt doch „Textem“ mit langem zweiten „e“, nicht wahr?
Die meisten sagen „Textem“, weil sie denken, es käme von Text. Aber es ist ein langes „e“ wie bei Morphem und Phonem aus der Linguistik. Ich kann es nicht so richtig gut erklären. Es ist in etwa eine Textbaueinheit eines Satzes.
Viele Verlagsgründer sind doch unglaublich programmatisch bei ihrer Namensgebung.
Nein, bei uns war es so, dass wir die Webseite, mit der es angefangen hat, dietexte.de genannt haben. Da haben wir unsere eigenen Texte in unredigierter und ungekürzter Version hineingestellt, weil wir natürlich immer beleidigt waren als Autoren, wenn die Redaktionen zu viel darin herumdokterten. Dummerweise gab es um die Ecke eine Firma, die „die Texte“ hieß. Deshalb musste ich mir relativ schnell einen neuen Namen einfallen lassen und den habe ich aus dem Lexikon. Ich finde es ganz gut, dass es eine Null-Aussage ist.
Manche kleinen Verlage wollen partout klein bleiben. Ist es für Textem erstrebenswert, zu wachsen?
Der Nautilus-Verlag hat mit seiner Autorin Andrea Maria Schenkel richtig Reibach gemacht und vorher jahrzehntelang von irgendwelchen Förderern oder Ausbeutung gelebt. Mit dem zweiten Titel ging es natürlich nicht mehr so gut, mit dem dritten war das ganz klar – aber sie mussten, weil die Grossisten, Thalia, Libri et cetera sagten, wir nehmen den Titel nicht auf, wenn ihr nicht so und so viel davon liefert. Das heißt, sie mussten eine Menge produzieren, von der sie von vorneherein wussten, dass sie sich nicht verkaufen würden. Zu solchen Sachen habe ich keine Lust. Von daher ist das, was wir machen, die absolute Unabhängigkeit. Das es mit dem Geld hapert, ist eine andere Frage. Elitär finde ich uns gar nicht, wir fühlen uns eher albern.
Albern?
Es ist ein Überschuss-Projekt. Einige Freunde von mir, die eben nicht Philosophie studiert haben, sind erschlagen allein aufgrund der Masse in so einem Kultur & Gespenster-Heft. Ich sage dann immer: „Blätter’ doch einfach, vielleicht bleibst du irgendwo hängen, etwa bei der Reise-Strecke“. Dass wir es intellektuell nicht drunter machen wollen, ist schon klar, aber das hat eher einen aufklärerischen Aspekt für uns, eine Weiterbildungsmaßnahme für uns selbst. Wir lernen mit jeder Ausgabe dazu, weil wir das vorher auch alles nicht wissen.
Was genau meinen Sie mit „drunter“?
Gucken Sie in die Welt und Sie sehen, dass so getan wird, als ob man wüsste, wie dumm die Leser sind. Es wird alles kaputt redigiert, alle Hürden des um-die-Ecke-Denken-Müssens kommen weg. Bei uns schreiben zum Teil Autoren aus universitären Zusammenhängen – aber unsere Hoffnung ist, dass sie nicht universitär schreiben.
Die Themen der Reihe Stimmungsatlas – von Angst bis Verkrampfung – wirken im besten Sinne bunt. Suchen Sie gezielt oder kommen die zu Ihnen?
Man sieht hier ja schon einmal: zweimal A, einmal V, einmal N, dann kommt Z wie Zeit, dann L wie Laune – man sieht daran schon, dass uns das Alphabet nur als enzyklopädischer Aufhänger interessiert und weil es schön aussieht. Gerade gestern habe ich Bilder geschickt bekommen aus dem Voo-Store in Berlin, das ist ein Modeladen – da liegen die Bücher zwischen den Klamotten. Das ist sowieso ganz interessant: Eine bestimmte Art von Künstlerbüchern vermittelt sich eher über Boutiquen. Die Buchläden haben meist keinen Platz für Kleinverlage, deshalb gibt es eher sonderbare Boutiquen, wo auf einmal solche Titel liegen.
Gibt es Titel, die Ihnen besonders wichtig waren?
Den Roman „Vondenloh“ wollte ich unbedingt machen. Frank Witzel ist gar nicht so unbekannt, er hat bei Nautilus schon einige Bücher herausgebracht. Für ihn war es eher tragisch: Wir haben nichts verkauft.
Gar nichts?
20 Stück vielleicht. Da ging nichts, auch bei den Rezensenten nicht. Ich habe überall Freunde, und wenn Volker Weidermann schreibt, der Chef des Feuilletons der FAS, dann wird es sowieso gekauft. Aber bei diesem Buch sagte er, er habe es nicht zu Ende lesen können, weil das Cover so hässlich gewesen sei. Das ist natürlich total blöd: Das Cover war vom Autor selber gezeichnet und passt wahnsinnig gut. Ich schenke es Ihnen, es ist eines meiner Lieblingsbücher.
Noch einmal zum Albernen.
Man braucht all das nicht, was wir machen. Es gibt keine Notwendigkeit, es zu besitzen oder zu lesen. Das heißt nicht, dass wir nicht Debatten lostreten wollen oder können. Aber es ist nicht dieses Checker-Universum, wo man alle fünf Minuten auf Spiegel Online gucken muss, was los ist. Wir finden uns zwar aktuell, aber manchmal muss man schon um die Ecke denken, um den aktuellen Bezug zu finden.
Um auf Ihren Brotjob zu kommen: Hat es einen Einfluss, dass Sie viel Zeit als Korrektor von Wirtschaftstexten verbringen?
Diesen Job habe ich erst seit November. Ich war in allen Redaktionen: bei der taz, beim Spiegel, bei MACup, das ist eine Computerzeitschrift, bei der Financial Times. Ich lese quer durch die Bank, auch Comics für Carlsen und Reprodukt. Wirtschaft interessiert mich nach wie vor nicht die Bohne. Man lernt auch in den Zeitschriften nichts darüber. Manager lesen darin, dass andere Manager auch gerne essen gehen, und freuen sich.
Noch einmal zum Geld: Ist der Verlag als Liebhaberprojekt gedacht?
Gedacht ist es schon so, dass er sich selber trägt. Aber das hat bislang nicht funktioniert. Obwohl Kultur & Gespenster so gut in der Presse ankommt und eigentlich ganz gut gekauft wird, hat es sich nie auf Null gerechnet – nur die erste Ausgabe, die Schwarz-Weiß gedruckt war.
Wie lösen Sie das?
Bislang war das mein Geld, dann hatte ich länger keines, dann haben meine Kollegen Nora und Jan die Stimmungsatlas-Reihe mitfinanziert. Ansonsten sind viele Titel, die wir gerne drucken würden, noch in der Schublade.
Wie ist die Stimmung?
Für die Autoren übernehmen wir die seelische Betreuung. Wir selber freuen uns, wenn etwas geht. Wenn nicht, dann nicht. Natürlich regt man sich ein bisschen über die Buchhändler auf, sie sind unglaublich schnarchnasig. Klar, sie haben wenig Platz für die Auslagen, aber man hat natürlich gehofft, dass sie den Stimmungsatlas cool finden und neben die Kasse legen. Aber es ist auch unsere eigene Schuld.
Inwiefern?
Der Mairisch-Verlag zum Beispiel ist viel straighter. Die haben ein viel klareres Außenbild, eine klarere Idee von den Lesern. Aber wir haben auch genau daran Spaß, dass wir nicht in eine Schiene passen, wir haben Leser von 80 bis 15 Jahren und das ist zugleich unsere Freiheit. Das Modemagazin Der schöne Mann ist uns auch so zugeflogen. Jetzt haben wir erst einmal die Tragik, dass Spiegel Online darüber berichtet hat, die Bestellungen schwappen herein und wir haben keine Exemplare mehr.
Indiskret gefragt: Wenn Sie und Kollegen den Verlag finanzieren, gehören Sie der glücklichen Erbengeneration an?
Überhaupt nicht. Ich kriege als Korrektor für zehn Tage etwa 2.000 Euro, 1.000 brauche ich für meine Wohnung in Berlin und Hamburg, plus Handy – der Rest geht in den Verlag. Andere von uns haben noch weniger.
Wie gut lässt sich der Verlag sozusagen nebenbei organisieren?
Ich muss täglich Mails beantworten und die Bestellungen weiterleiten, das mache ich nebenbei oder nachts. Die richtige Arbeit kommt akut zustande. Gerade ist Pause, die nächste Ausgabe von Kultur & Gespenster ist im Druck und ich habe nur einen Stapel E-Mails zu beantworten, wo ich Manuskripte ablehne. Da muss ich mir etwas Nettes ausdenken, damit die Leute nicht enttäuscht sind und sich wieder melden. Viele Autoren schicken manchmal Scheiß, aber das heißt nicht, dass sie es immer tun.
Die Kunst der schönen Absage.
Manchmal ist es nur ein Halbsatz, dass der Text nicht ins Programm passt. Aber wenn ich merke, da ist Potenzial, versuche ich zwei oder drei Sätze. Das kann ich aber nur zu ganz bestimmten mentalen Zeiten, dann haue ich 20 Absagen in einer halben Stunde heraus, aber vorher winde ich mich und kann überhaupt nicht rangehen.
Denkt Textem über E-Books oder Apps nach?
Magazine sind so scheißgeil. Hier bei Gruner + Jahr sowieso.
Ich dachte, jeder will ein Buch schreiben.
Magazinmacher sind noch cooler. Jeder will das und dann kommen so Sachen wie Beef und Business Punk und Dogs heraus. Aber zu den Magazinen: Das funktioniert durch das Haptische. Und das Abgeschlossene hat man im Internet eben nicht. Die komische App-Philosophie hat ja auch etwas mit einer absichtlichen Verknappung zu tun. Das, was man einmal im offenen Internet hatte, wird reduziert. Ich bin nicht gegen moderne Medien, es muss nur passen, selbst die Fußnoten hier sind nicht so einfach.
44, wegen der Musik der Hamburger Schule 1994 nach Hamburg gekommen, hat dort und in Frankfurt am Main Philosophie studiert.
Freier Journalist u. a. für taz, Financial Times und die philosophische Zeitschrift Widerspruch. Korrektor u. a. bei Capital.
Den Verlag Textem gründete er gemeinsam mit Freunden, erste Hefte erschienen dort 2002. Die Kulturzeitschrift Kultur&Gespenster gibt es seit 2006, die Reihe Stimmungs-Atlas startete 2011, das Mode-Magazin Der schöne Mann der Hochschule für Künste Bremen kam 2012 heraus.
Friederike Gräff, taz, 18. 3. 2012
KREUZFAHRT DURCH DEN KREATIVSEKTOR
Manchmal sind Titel nicht nur zündend, sondern auch visionär. Zumindest scheint es so. Als die Macher der Zeitschrift „Kultur & Gespenster“ ihre 13. Nummer mit dem Titel „Stabile Seitenlage“ planten, dachten sie vielleicht an Prekariat, Selbstausbeutung oder Erste-Hilfe-Kurse. Sie ahnten aber wohl kaum, dass im Januar 2012 vor der toskanischen Küste ein Kreuzfahrtschiff mit dem sprechenden Namen „Costa Concordia“ auf Grund laufen und havarieren sollte. Die Rettungsaktionen verliefen, wie man weiß, dramatisch. Menschen kamen zu Schaden und ums Leben. Wer die Bilder des ramponierten Traumschiffs auf sich wirken ließ, kam kaum umhin, ihnen neben dem dokumentarischen auch einen allegorischen Wert beizumessen. Aus Traum und Traumreise war ein Albtraum geworden, der auf die Vorstellung der euro-amerikanischen Upper Class, sich den geschundenen Erdball als Spielwiese zur unverfänglichen Erbauung herrichten zu lassen, seinen Schatten warf. Im Gegensatz aber zum spektakulären Inferno der „Titanic“, die vor ziemlich genau 100 Jahren mit einem Eisberg kollidierte und Tausende in den Tod riss, kippte die „Costa Concordia“ schlicht zur Seite und blieb fürs Erste liegen. In dieser stabilen Seitenlage geisterte sie noch eine Weile durch Gazetten, Internet und Funk und Fernsehen, verschwand aber alsbald, während das baugleiche Schwesternschiff, die „Costa Serena“, trotz des Unglücks ein paar Tage später ausgebucht in See stach.
Dieses „Business as usual“ im Angesicht des Desasters sagt vielleicht mehr über unsere Situation aus als uns lieb sein könnte. Deutet es doch an, dass die Katastrophe, auf deren Eintreffen wir in einer Mischung aus virtueller Panik und Nervenkitzel starren, womöglich längst stattgefunden hat. „Dass es so weitergeht, ist die Katastrophe“, notierte einst Walter Benjamin, nicht ahnend, welches Haltbarkeitsdatum seinem Aperçu beschieden sein würde. „Stabile Seitenlage“ jedenfalls ist nicht nur ein gewitzter Einfall für eine Zeitschriftennummer, sondern auch eine hochpräzise Metapher für ein gewiss nicht ohne Grund weitverbreitetes Lebensgefühl.
Dabei ist „Kultur & Gespenster“ ohnehin eine der innovativsten Erscheinungen der letzten Jahre auf dem deutschsprachigen Zeitschriftenmarkt: 2006 erstmals erschienen und von Jan-Frederik Bandel, Gustav Mechlenburg, Nora Sdun und Christoph Steinegger verantwortet, 2010 mit der Auszeichnung in Silber beim LeadAward, einem deutschen Medienpreis, mehrfach gewürdigt. Als Kulturzeitschrift apostrophiert, steht das Journal womöglich für die Tendenz, nach der Flut an soft-seichten Hochglanzheften, an Lifestyle- und Zeitgeist-Magazinen wieder verstärkt die intellektuelle Debatte zu suchen, ohne in den bärbeißigen Jargon früherer Jahre wie dessen Textlastigkeit zurückzufallen. Dabei wird die Unschärfe, was genau der Gegenstandsbereich von „Kultur & Gespenster“ sein soll – Bildende Kunst, Literatur, Politik, Wissenschaft und Hochschule, Kultur und Kulturwissenschaften – zumindest billigend in Kauf genommen.
Die neueste Nummer ziert das Faksimile der ersten Seite eines handschriftlichen Briefes an Theodor W. Adorno. Philipp Felsch und Martin Mittelmeier kommentieren diese und weitere Korrespondenzen, die Adorno, dem vielleicht letzten „universellen Intellektuellen“ von Format, mit seinen Lesern pflegte. Dass ihr Interesse dabei nicht nur ein historisches ist, steht zu vermuten. Denn sichtbar werden in den Leserbriefen an den Maestro nicht nur die „Kollateralschäden einer Theorie ums Ganze“, sondern zwischen den Zeilen auch deren Notwendigkeit, dieses Ganze heute anders und mit anderen Mitteln zu denken. Man glaube doch bittschön nicht, dass ausgerechnet Foucault, Deleuze, Derrida & Co. diesen Anspruch platterdings preisgegeben hätten. Die Tristesse an den Universitäten etwa hat vielleicht nicht nur mit rapide steigenden Studentenzahlen und chronischer Unterfinanzierung zu tun, sondern mit einer akademischen Kleinteiligkeit, ja Kleingeistigkeit, die gar nicht mehr wagt, auch nur ansatzweise über den Tellerrand der drittmittelfinanzierten Forschungsprojekte hinauszuschauen. Pierangelo Maset und Daniela Steinert protokollieren die institutionalisierte Depression des deutschen, William Pannapacker die des amerikanischen Universitätsbetriebs punktgenau. Die von Johannes Hoff an Hugo Ball, einem der entscheidenden Protagonisten der Dada-Bewegung zu Beginn des vorigen Jahrhunderts, rekonstruierte Neubestimmung des Verhältnisses von Wissenschaft, Kunst und Religion wird vor diesem Hintergrund verstörend aktuell.
Was es sonst noch zu entdecken gibt? Beispielsweise eine ausführliche Rückschau mit den Kuratoren Britta Peters und Tim Voss und allen beteiligten Künstlerinnen und Künstlern auf die Ausstellungsserie „Reihe:Ordnung“, die von 2007 bis 2009 im Kunstverein Harburger Bahnhof entwickelt und dortselbst realisiert wurde; ein mitreißendes Comic von Jul Gordon (Cousin Edward kommt zu Besuch); ornamentale Zeichnungen von Anke Wenzel (Arcadia Diabola) sowie ein überreiches Potpourri an Bildern, Fotos, Zeichnungen und Aufzeichnungen, Notizen, Rezensionen, Essays, Gedichten – und vieles mehr. Die Lektüre lohnt sich.
Jan-Frederik Bandel, Gustav Mechlenburg, Nora Sdun, Christoph Steinegger (Hg.): Kultur & Gespenster, Nr. 13: Stabile Seitenlage. Textem Verlag, Hamburg 2012. 296 Seiten. ISBN 978-3-941613-05-8. EUR 12,00
Michael Mayer, artnet März 2012
Zeitschriftenschau

Wenn die Sprache von einer feindlichen Macht übernommen wird – in diesem Fall vom Büro bzw. dem Jargon, der in ihm gepflegt wird –, dann bemerkt man das zuerst an den Worten, die von ihr in den allgemeinen Gebrauch eingepflegt werden: Selbstoptimierung, Assessment-Center, Ich-Kapital, Audits.
Das Leben im Büro hat mit Wortmasken die Sprache kolonisiert – und das dazugehörige Denken mit dem sogenannten Bologna-Prozess die deutsche Hochschule. Das Autoren-Doppel Daniela Steinert und Pierangelo Maset hat für die aktuelle Nummer von Kultur & Gespenster einen gleichermaßen erhellenden wie erschreckenden Essay zur Lage der Bildungsnation in der sogenannten Wissensgesellschaft beigesteuert:
"Die Reformen, die ... gegenwärtig eine Überbietung aller Bürokratie-Albträume realisiert haben, verbanden konsequent das bürokratische italienische Hochschulsystem mit dem kontrollintensiven angelsächsischen. Die europaweite Reform ... kann vor allem dadurch charakterisiert werden, dass eine zentralistisch angelegte politische Steuerung die Geschicke der Hochschulen leitet ... Das bereits absehbare Ergebnis ist eine europäische Hochschullandschaft eines – mit Verlaub – höchst porösen Europa, die weniger mit der Freiheit von Forschung und Lehre als weitaus mehr mit den Verfahren von Controlling und Benchmarking zu tun hat. Exzellenz-Rhetorik, begleitet von durch BWL-Kenntnisse korrumpierter Forschung halten ihren Einzug in die Hochschulen ebenso wie ununterbrochene Preisverleihungen und sinnwidrige Prestigeprojekte."
Daniela Steinert und Pierangelo Maset
Bildung ist zum profitablen Feld für Controller verkommen, die es wie Vandalen verheeren. Statt Autonomie der Bildung wird diese radikal ökonomisiert und wirtschaftlichen Interessen unterworfen. Was im radikalen Gegensatz zu Artikel 5 des Grundgesetzes steht, wo es heißt, dass die Freiheit von Forschung und Lehre unbedingt zu wahren sei. Wissenschaft wird dagegen zum Dienstleister degradiert; der Beamte zum Unternehmer stilisiert. In den Fluren der Hochschulen regiert akademischer Darwinismus. Jeder beißt den ihm Nächsten weg. Man lasse folgenden O-Ton aus einem Antrag zur Einwerbung von Drittmitteln im eigenen Gehörgang sein dürftiges Leben aushauchen:
"Projekte mit der Kreativwirtschaft im Bereich der visuellen Kunst haben von der Besonderheit des Weiterbildungsprozesses bzw. der Wertbildungskette der künstlerischen Produktion auszugehen ... Im Prinzip ist es durchaus möglich, im Bereich von lediglich drei- oder vierstelligen monetären Größen und der individuellen Arbeitszeit eines Produzenten, die sich auf weniger als eine Woche beläuft, Produkte zu generieren, die auf dem Markt Preise in etwa sechsstelliger Höhe erzielen."
aus einem Drittmittel-Antrag
Man spricht von der unternehmerischen Hochschule. Der esoterische Bluff der Wortkulissen aus dem Hause McKinsey & Konsorten ist zum autokratischen Maßstab promoviert.
Wir sind sicher, dass das nur passieren konnte, weil zum Zeitpunkt der Einführung dieses Maßstabs – irgendwann Ende der 90er – die meisten Menschen gesessen haben. Statt auf einer Couch zu liegen und den Junk mit lässiger Armbewegung in die Senkgrube zu befehlen. Das Autorenduo schreibt in Kultur & Gespenster:
"Was von McKinsey & Co. entwickelt wurde, sind im Grunde manipulative Psychotechniken, die die Aufmerksamkeit und das Denken mit einer bestimmten Matrix besetzen sollen."
Daniela Steinert und Pierangelo Maset
Anders gesagt: McKinsey ist das neue Scientology. Nehmen wir die Einführung externer Hochschulräte. Das ist etwa so, als wenn man eine externe Bundesregierung einführt, die, sagen wir, von den Kaiman-Inseln aus das Parlament des Bundestags betört. Damit sind demokratische Verfahren außer Kraft gesetzt. Die Esoterik McKinseys trifft hier ihren eigenen Kern.
Zur Verdeutlichung dessen, wozu Hochschulen inzwischen degeneriert sind, betrachte man den Werbespot der Universität Lüneburg unter: www.leuphana.de.vu – vom amtierenden Präsidenten übrigens als erfolgreiche „virale Kommunikationsstrategie“ gepriesen, obwohl der Film ursprünglich – und Achtung: jetzt wird man sich vor Lachen gleich auf die Chaiselongue schmeißen – die Satire eines kritischen Geistes darstellte. Wäre es nicht so absurd, könnte man es nicht glauben.
Universitäten wandeln sich unter dem Diktat zu Zuchtanstalten gleichförmiger Kadetten, die sich mit ihrem von ökonomischen Weisheiten vernebelten Hirn als Elite begreifen. Die Angst vor dem Individuum ist epidemisch. Auf das Artensterben folgt das Geistessterben.
Ein weiteres Highlight im aktuellen Kultur & Gespenster sind die Kolumnen von William Pannapacker, die aus dem im kiosk schon öfter empfohlenen The Chronicle for Higher Education stammen und von Kultur & Gespenster-Mitherausgeber Jan-Frederik Bandel ins Deutsche übertragen wurden.
"‚Du machst natürlich auch Theorie, oder?‘, fragte die Frau neben mir. Das war in einem meiner ersten Hauptseminare in Englisch. Sie trug eine lederne Motorradjacke voller Reißverschlüsse, und ihre Dreadlocks waren orange gefärbt. Es war in den frühen Neunzigern... Theorie wurde eine Hochstapelei, eine Methode, die nicht zu stemmende Arbeitslast auf ein paar Schlagwörter runter zu kürzen. ‚Ach bitte, die Intention des Autors ist hier wirklich irrelevant.‘ ‚Alles ist politisch.‘ ‚Es gibt nichts außerhalb des Textes.‘ ... In unserem Alltag lebten wir in geradezu sklavischer Anpassung, und gleichzeitig wurde uns beigebracht, subversive Geister zu verehren, ihnen nicht nur in Sachen Theorie nachzueifern, sondern auch in unserer Kleidung, Stimmlage und Körpersprache. ... Orthodoxe Meinungen durften niemals in Frage gestellt werden, nicht einmal spaßeshalber... Ich kannte eine Studentin, die ihre sexuelle Orientierung wegen einer Wochenendlektüre von Gender-Theorien änderte, und das war eine höchst ernsthafte Angelegenheit, nicht etwa eine Absurdität. Ich habe gehört, dass sie sich inzwischen wieder umentschieden hat."
William Pannapacker: The Chronicle for Higher Education (übersetzt von Jan-Frederik Bandel)
Der Begriff Theorie ohne bestimmten wie unbestimmten Artikel ist inzwischen zum unantastbaren Losungswort einer schamanistischen Praxis verkommen – in den USA wie bei uns. Unter den Adepten hält man weiter Ausschau nach dem nächsten großen Ding, auf das man aufspringen könnte, als wäre es
"der letzte Hubschrauber, der einen aus Saigon rausholt."
Kultur&Gespenster
Nicht im Sitzen, sondern nur im Liegen kann man eine Stabile Seitenlage einnehmen. Also in der idealen Haltung, um nachzudenken. So hat auch das aktuelle Kultur & Gespenster klugerweise seinen Themenpark mit diesem Begriff versehen. Befehl von ganz unten: Unbedingt lesenswert!
Kultur & Gespenster erscheint vierteljährlich im Textem-Verlag, Hamburg, und kostet im Einzelverkauf € 12,00
Thomas Palzer, Zeitschriftenschau, Bayern 2, März 2012
Road Trip durch die USA

Der Fotograf Volker Renner reiste 2010 durch die USA, von der West- zur Ostküste und zurück. Er stoppte in kleinen Städten und fotografierte Straßen, Parkplätze und Motels. Renner folgte der Route, die Stephen Shore, ein Pionier der künstlerischen Farbfotografie, 1973 gefahren war – und fotografierte die gleichen Orte, sofern sie noch existierten. Renner schreibt über sein Projekt A Road Trip Redone, er sei Shores Aufnahmen gefolgt "wie ein Pilger – oder wie ein Tourist, der seinen Attraktionen folgt". Der Bildband erscheint im Textem Verlag.
ZEIT online, März 2012, www.zeit.de/reisen/2012-03/fs-volker-renner
Treffen der Merkwürdigkeiten

Der Titel ist eine bewusste Irreleitung: Items for possible Video Sets nennt der Video- und Fotokünstler Stefan Panhans seine Stilleben. Doch die Bilder sind keineswegs Skizzen für Videoarbeiten. Die inszenierten Collagen aus Konsumartikeln wie Turnschuhen und Plastikwimpern sind völlig eigenständig und persiflieren die Werbefotografie. Panhans Arbeiten sind bis zum 9. April in der Gruppenausstellung Über die Dinge in derKulturstiftung Schloss Agathenburg zu sehen. Wir zeigen Bilder aus dem Band Untitled & Items for Possible Video Sets (Textem Verlag).
ZEIT online, 3. März 2012: http://www.zeit.de/kultur/kunst/2012-02/fs-stefan-panhans
A wie Albernheit
"Sie kennt keinen Anstand und keine Gnade", schreiben Michael Glasmeier und Lisa Steib in ihrem Buch "A – Albernheit", erschienen in der Reihe "Kleiner Stimmungsatlas in Einzelbänden". Ich lache nicht – ich werde gelacht: Im Gespräch erklärt Michael Glasmeier das anarchische Wesen der Albernheit.
Tobias Nagorny im Gespräch mit Michael Glasmeier, [6:04]
Buchtipp: Glasmeier, Michael/Steib, Lisa: Kleiner Stimmungsatlas in Einzelbänden: A – Albernheit, Textem 2011, 120 Seiten, 12,00 Euro
Radio Bremen 19. 2. 2012
Helden in Strickshorts
Mit Brusthaar oder ohne, kernig oder feminin: Männer haben mehr Möglichkeiten zur Selbstdarstellung als je zuvor. Studenten der Hochschule für Künste Bremen haben dem Phänomen "Der schöne Mann" ein ganzes Magazin gewidmet - denn fesche Kerle braucht das Land.
So richtig schön ist dieser schlacksige, rotbärtige Mann auf dem Foto nicht. Verträumt schaut er aus dem Fenster eines Baumhauses. Seine nackten Käsebeine stecken in blauen Strickshorts und korallroten Lycrasocken. "Mir ging es nicht so sehr um das Aussehen, sondern um die Eigenschaft des Mannes, sich seine Kindlichkeit zu bewahren. Das wollte ich in der Kleidung durchblitzen lassen", sagt die Modedesign-Studentin Elena Clausen, 29, über ihre Kollektion.
Der Rotbärtige setze zielstrebig wie ein Erfolgsmann vom Typ George Clooney abstruse Ideen à la Jürgen Vogel um: "Er ist einer, der mit ein paar Latten und Nägeln ganze Baumhäuser baut." Insgesamt 50 Studenten im Fach "Integriertes Design" an der Hochschule für Künste Bremen haben sich mit Texten, Fotos, Mode und Grafikdesign über drei Semester "Dem schönen Mann" gewidmet. Herausgekommen ist ein intelligentes Magazin im schweren Taschenbuchformat, das zum Nachdenken anregt.
Schon länger ist es auch für Männer salonfähig, halbe Monatsgehälter in Designermode oder Sammlungen limitierter Sneaker zu investieren. Vorbilder findet der stilbewusste Mann in Avantgarde-Magazinen wie "Fantastic Man", in Fashionblogs wie "Bryanboy.com", "The Fashionisto.com" oder "Dandy Diary" hält er sich über die Frühlingstrends von John Galliano bis Paul Smith auf dem Laufenden. Er scannt die neusten Streetstyles bei "The Sartorialist" oder informiert sich bei "Mr. Porter", wie man maßgeschneiderte Schuhe richtig pflegt.
Früher politische Rebellion, jetzt Ästhetisierung
"Vor allem junge Männer reagieren ganz extrem auf Mode", sagt die Kulturwissenschaftlerin und Heftherausgeberin Annette Geiger. Für viele sei Mode vielleicht das wichtigste Mittel der Identitätsfindung und Abgrenzung geworden. Dabei würde sich gerade die Generation Praktikum über ihren Stil förmlich von der Gesellschaft abkapseln: "Was bei früheren Generationen die politische Rebellion war, ist heute die Ästhetisierung."
Zeit also für eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema. Intellektuell geht es in "Der schöne Mann - Das Magazin" ganz schön zur Sache: Die Gastautoren haben philosophische und kunsthistorische Essays zur "Auferstehung der Brustbehaarung", der "Schönheit des Antihelden" oder einen "Abgesang auf den Herrn" verfasst, die Studenten die männliche Attraktivität in einem "ABC des schönen Mannes" eingefangen. Sie untersuchen die Garderobe Don Drapers aus der Serie "Mad Men" ebenso wie den Zusammenhang von Outfit und Macht bei Barack Obama und dem chinesischen Staatsoberhaupt Hu Jintao.
Vor allem aber kreieren die Studenten in 15 Kollektionen ihre ganz eigenen Versionen eines schönen Mannes und setzen sie in Fotostrecken in Szene. So wählt Student Harm Coordes den Obdachlosen als Inspiration für seine Entwürfe; Svetlana Willer entwirft für den coolen, modernen Hausmann lässige, der Streetwear entlehnte Outfits und inszeniert ihn auf Waschmaschinen und Mikrowellen. Die türkischstämmige Dilay Baris kleidet den "westöstlichen Dandy" in minimalistische Capes und Hemden. "Superhelden im Schafspelz" streifen in silbernen Leggins und grünen Strickjacken durch sommerliche Wiesen. Sogar ein erotischer Jesus spreizt in grobgestricktem Hemd und Kreuzkrone lasziv die Beine auf einer Fensterbank.
Individualität ist Trumpf
Jede Kollektion zeigt ihre ganz individuelle Vorstellung von Männlichkeit - vom verträumten, jungenhaften Kreativen bis zum steifen Vampir, ein breites Spektrum, auch bei den Models. Dabei bleiben die markanten Gesichter der Profimodels, ihre Schmolllippen und glattrasierten Brustpartien weniger im Gedächtnis hängen als die Halbglatze und der Bierbauch des Kommilitonen, der sich in weißer, loser Kleidung in eine verwüstete Umgebung gestellt hat.
Student Coordes sagt auf der Releaseparty des Hefts in Hamburg: "Jeder Mann möchte etwas Einzigartiges darstellen". Das ist sicher der Anspruch aller Entwürfe in "Der schöne Mann". Doch Coordes - mit rotem Talibanbart, Hochwasserhosen in Boots und kuscheliger Strickjacke - stellt fest, dass Anspruch und Wirklichkeit auf der Straße weit auseinanderklaffen: "Eigentlich sehen die Leute überall gleich aus."
Das mag an den großen Modeketten liegen. Oder daran, dass über das Internet die Trends aus New York und Tokio simultan im Umland von Herford verfügbar geworden sind. Die Modewelt sei gewissermassen "gleichgeschaltet". So fänden sich enge Jeans im skandinavischen Stil, knallbunte Ray-Ban-Brillen und das Fixie-Rennrad in Kopenhagen ebenso wie in Peking, sagt Coordes: "Das ist schade."
Zumal "Der schöne Mann" zeigt, dass der junge Mann mit Faible für Farben und Formen mehr modische Freiheiten hat als je zuvor. Um schön zu sein - das postuliert das Magazin - braucht ein Mann heute weder den Körperbau von Beckham, das Lächeln von George Clooney oder die Moneten von Bill Gates. Mann kann wild, haarig, naturburschig sein, ein unterernährter Nerd oder ein androgynes Wesen, Anzug tragen oder ein speiseeisfarbenes Wallegewand - gesetzt den Fall, dieses unterstreicht Charakter und Persönlichkeit und Er fühlt sich damit wohl.
Herausgeberin Annette Geiger sagt: "Die Mode würde es heute niemandem mehr verzeihen, wenn er über Kleidung etwas darstellen möchte, was er nicht ist." Oder wie es eine Leserin bei der Releaseparty zum Magazin sagt: "Eine klare Idee von sich haben und die gekonnt umsetzen. Das ist schön, richtig schön."
Spiegel online Februar 2012 Lu Yen Roloff
Empfindung verarbeitet in Karten
Jan-Frederik Bandel und Nora Sdun (Hg.): "Kleiner Stimmungsatlas in Einzelbänden", Textem Verlag, Hamburg 2011
Die Essays über Angst, Albernheit und andere Stimmungen werfen viele Fragen auf. Subjektive Empfindungen lassen sich schlecht objektiv darstellen. Die Essays haben keine gemeinsame Grundstimmung, einige Bände aber fördern tatsächlich die Orientierung in der Gegenwart.
Wer nicht großzügig gestimmt ist, wird am "Kleinen Stimmungsatlas" einiges zu bekritteln haben: Sind "Bildzweifel" - falls jemand weiß, was das ist - etwa eine Stimmung? Ist es "Modernität"? Und warum präsentiert man subjektive Stimmungen in einem Atlas, der die Welt per Definition kartographisch-objektiv darstellt? Die Herausgeber Jan-Frederik Bandel und Nora Sdun kennen solche Einwände gegen ihr "universalenzyklopädisches Unterfangen", geben sich in Interviews jedoch betont "realitätsverkennend und größenwahnsinnig", also provokativ. Sie kämpfen gegen das "Schreckensregime des fröhlichen Oberflächenwissens" und wollen der ästhetischen Weltbetrachtung neue Perspektiven eröffnen. Soweit also die Absichten.
Zunächst einmal: Die einzelnen Essays haben keine gemeinsame Grundstimmung. Thomas Ganns "Angst"-Atlas zum Beispiel bietet solide literaturwissenschaftliche Aufsätze. Man lernt das "Zischen" in Kafkas Erzählung "Der Bau" als Akustik der Angst kennen, Ernst Jüngers heroische Blutoper "In Stahlgewittern" erscheint als Panzerung einer angstvollen Psyche. Insgesamt verbreitet das Bändchen gehobene germanistische Sammelband-Atmosphäre, von den speziellen Ängsten der Gegenwart ist allerdings nichts zu spüren.
Frecher geht der Künstler und Manager Armin Chodzinski dagen mit der "Verkrampfung" um. Nach einem Ausflug an die Umtauschkasse bei Ikea häuft Chodzinski apodiktische Urteile ("Im Sport und beim Sex steigt die Verkrampfung"), gefällt sich in Zeitgeist-Rhetorik ("Der Hahn ist tot. Calvin lebt"), bietet Definitionen ("Das verkrampfte Subjekt hat keine Angst, es denkt in Rücksichten und Sprachlosigkeiten") und steigert sich zu der erstaunlichen These "Verkrampfung ist ein Problem des Raumes". Gleichzeitig erscheint Verkrampfung als Defekt in der Beziehung zwischen Individuum und Möglichkeitswelt, was zum "Zerbrechen am Konjunktiv" führt. Davon hat man schon gehört, aber egal. Chodzinski und wie er die Welt sieht: Das passt zum Atlas-Projekt.
Den bislang besten Essay haben Michael Glasmeier und Lisa Steib über "Albernheit" geschrieben. Albernheit, die - wie Angst - immer kommt, wann sie will, nicht wann wir wollen, ist anarchistisch und unterläuft die Rituale der Sinn-Produktion. Kant befand, dass "nicht wenig Geist dazu gehöre den Verstand für kurze Zeit von seinem Posten abzurufen". Glasmeier und Steib bleiben auf dem Posten, erfreuen sich aber an der spaßigen Abberufungs-Option. Was man von Dieter Wenk, der eine rein literaturhistorische Betrachtung zur "Modernität" liefert, und von Stefan Ripplinger, der komplex-kompliziert über "Bildzweifel" (zwischen Bildgläubigkeit und Bilderstürmerei) nachdenkt, kaum sagen kann. Beide Bände sind so kompetent wie trocken. Während die Erkenntnis steigt, sinkt die Stimmung. Das tut der sympathischen Atlas-Idee nicht gut. Text-Exerzitien kann man sich ja auch anderswo verschaffen.
Das Fazit nach fünf Bänden: "Angst", "Bildzweifel" und "Modernität" sind historische Atlanten zur Orientierung in der Vergangenheit. Die aktuellen Atlanten "Albernheit" und "Verkrampfung" fördern die Orientierung in der Gegenwart. Davon gern mehr.
Besprochen von Arno Orzessek
Jan-Frederik Bandel und Nora Sdun (Hrsg.): "Kleiner Stimmungsatlas in Einzelbänden"
Bd. 1: Michael Glasmeier und Lisa Steib: "Albernheit"
Bd. 2: Thomas Gann: "Angst"
Bd. 3: Armin Chodzinski: "Verkrampfung"
Bd. 4: Dieter Wenk: "Modernität"
Bd. 5: Stefan Ripplinger: "Bildzweifel"
Textem Verlag, Hamburg 2011ff
jeweils ca. 100 Seiten, 12 Euro
Deutschland Radio Kultur 14. 2. 2012
NDR 24. Januar 2012: Der schöne Mann - Modemagazin
A wie Angst
Der "Stimmungsatlas in Einzelbänden" ist eine ganz besondere Enzyklopädie. Thorsten Jantschek spricht mit dem Autor, dem Hamburger Literaturwissenschaftler Thomas Gann, über den Band zum Thema "Angst".
Thorsten Jantschek im Gespäch mit dem Autor Thomas Gann, [15:09]
Buchtipp: Gann, Thomas: Kleiner Stimmungsatlas in Einzelbänden: A – Angst, Textem 2011, 72 Seiten, 12,00 Euro
Radio Bremen, 12. Februar 2012, 11:05 Uhr
Visionäres Männer-Mode-Magazin wird vorgestellt
taz: Frau Geiger, Ihr Magazin Der schöne Mann präsentiert eine "Vision zu Mann und Mode". Was muss man sich darunter vorstellen?
Annette Geiger: Unsere Frage an die Studierenden, die alle um die 25 Jahre alt sind, war: Wie wünscht ihr euch einen schönen Mann? Für jede Generation sieht ein schöner Mann ja anders aus. Und das glatte Schönheits-Ideal will heute keiner mehr.
Aber von den Magazinen lächeln doch immer noch Schönlinge wie Brad Pitt.
Natürlich besteht weiterhin Interesse an äußerer Ästhetik. Man kann aber sagen, dass es in der Mode kein einheitliches Schönheitsbild mehr gibt. Uns geht es um die Formulierung von Brüchen und Dissonanzen. Der schöne Mann - der Titel ist übrigens ironisch gemeint - hat sehr viele Risse.
Ihre Kollektionen folgen also keinem einheitlichen Modell?
Nein, die Visionen sind alle sehr unterschiedlich. 15 Studierende haben 15 Modekollektionen entworfen. Heute sind alle Identitäts- oder Modemodelle parallel möglich. Unsere erste Fotostrecke hat das Thema Obdachlosigkeit. In Berlin-Mitte sind die hippen Leute von den Obdachlosen zum Teil gar nicht mehr zu unterscheiden. Gleichzeitig aber finden Sie dort auch sehr viele androgyne Männer. Die Verschiedenheit der modischen Möglichkeiten ist heute so groß wie noch nie. Das ist das, was unser Heft sehr schön darstellt.
Sind noch weitere Ausgaben geplant?
Unbedingt, obwohl die erste Ausgabe über ein Jahr bis zur Fertigstellung gebraucht hat.
Gibt es schon einen Titel?
Ja: "Die hässliche Frau".
INTERVIEW: EFK, taz 3. 2. 2012
Kuppelmutter Rom

Ein skurriler Band will zeigen: Die Welt ist rund wie das Pantheon
Zum Beispiel N wie Narrenturm: Mit dem Bau des Pantheons lud der römische Kaiser Hadrian einst sämtliche Götter ins Zentrum des antiken Weltreiches ein; in Wien dagegen sollte fast zweitausend Jahre später der Bau der ersten psychiatrischen Anstalt Kaiser Joseph II. als Herrscher einer rationalen Welt erweisen. Beide Gebäude sind rund wie das Universum, haben Kreis und Kugel als Konstruktionsprinzipien. Auf fünf Ringen zu 28 Kassetten steigt die römische Kuppel bis zum Opaion auf, dem im Sommer wie im Winter offenen Lichtauge; auf fünf Stockwerken wiederum durften die Narren einst durch je 28 Fensterschlitze lugen.
Seit Christoph Grau sich irgendwann in den 1970er Jahren in das antike Architekturwunder verliebte, erscheint ihm die Welt, wie er gern zugibt, 'pantheongefiltert', verweist ihm das 'Weltzeichen' zu Rom auf alles wie nichts. Wenn er nun in 47 Texten einen Einblick in die 'Wunderkammer ohne stoffliche Sammlung' gewährt, so unterwirft er sie für uns Uneingeweihte nur eben der notdürftigsten Ordnung: der alphabetischen, in der freilich wiederum das Nachwort erst knapp vor den Narren und das Vorwort kurz vor dem Schluss kommt.
Mit dem 'Pantheon Projekt' liegt eine der merkwürdigsten Buchmarkterscheinungen im nostalgischen Oktavformat mit farbigen Lesebändchen vor, visuell nicht weniger anziehend mit Rundheiten aus Malerei und Fotografie gefüllt als textlich. Denn auch im persönlichen Weltreich des Herrn Grau - eines pensionierten Kunsterziehers und Galeristen, wie allerdings erst ein Anruf beim Verlag enthüllt - führen alle Wege nach Rom: von den Vorratskammern der verstorbenen Großmutter bis zur ersten Rolex zum fünfzigsten Geburtstag, von der Strebenkonstruktion einer aufgeschnittenen Zitrone bis zum Film 'Truman Show', in dem einst Jim Carrey die Grenzen seiner privaten Welt unter einer Kuppel fand. Denn 'das Pantheon erkennt, das Pantheon ordnet'.
Wie der Tempel schon in der Spätantike eine Umwidmung zur Kirche erfuhr, so weiht es nun Christoph Grau zur Opferstätte seiner selbstverständlich höchst subjektiven Privatreligion. Wer gläubig wird, findet in diesem Oberpriester einen gebildeten, charmanten, geistreichen und kultivierten Seelenführer; wer ungläubig bleibt, dem aber taugt das skurrile Bändchen nicht einmal zum Reiseführer.
CHRISTOPH GRAU: Pantheon Projekt. Textem Verlag, Hamburg 2011. 578 Seiten, 28 Euro.
MICHAEL STALLKNECHT, Süddeutsche Zeitung, 2. Februar 2012
Stimmungs-Atlanten

Ein Wort, ein Buch, ein "Kleiner Stimmungs-Atlas in Einzelbänden": Kolumnen und Essays aus der Gegenwart, mit Ausrutschern in die Vergangenheit und scheuen Blicken in die Zukunft. Die ersten fünf schmalen, kleinformatigen Büchlein aus dem Hamburger Textem-Verlag widmen sich jeweils einem Thema, das mit einem Schlagwort um die Ecke schnellt und in prägnant formulierten Untersuchungen und Meinungsdekreten sich, wie Michael Glasmeier und Lisa Steib, zum Beipsiel mit der "Albernheit" beschäftigt. Um die Begriffsbedeutung "albern" herum bauen die Autoren ihr Haus aus vielfältig konstruierten Glasbausteinen wie "Kalauer", "Thomas Kapielski" oder die Kunst des "Erwin Wurm". Thomas Gann hingengen schaut auf die "Angst", Armin Chodzinski kümmert sich um die "Verkrampfung", Dieter Wenk blickt auf die "Modernität" und Stefan Ripplinger hat viele "Bildzweifel". Kurzweilig und unterhaltsam, philosophisch und ironisch, packend und liebevoll: der Start einer Buchreihe, die niemals enden sollte.
Klaus Hübner, Westzeit 2/2012
Vision zu Mann und Mode

Der Hamburger Textem Verlag bringt das Magazin „Der schöne Mann“ in den Umlauf
„Männer dürfen nicht so dick auftragen wie Frauen, sie haben sich in subtileren Codes mitzuteilen“, schreibt Anette Geiger in einem Essay zur Kleidung von Künstlern und Intellektuellen im neuen Männermode-Magazin „Der schöne Mann“. Dennoch: Die Modewelt entdeckt den männlichen Körper für sich. Aber auch die Männer interessieren sich mehr für ihr Äußeres. Ein Blick auf die Webblogs von The Sartorialist und Street Etiquette genügt als Beweis. Studierende der „Hochschule für Künste Bremen“ untersuchten den Trend jetzt genau. Sie führten Interviews mit internationalen Fotografen und Designern, wählten Essayisten und Philosophen für Gastbeiträge aus, entwarfen fünfzehn Kollektionen und schrieben nieder, was sie zu ihren Arbeiten inspirierte. Wie kleidet sich eigentlich ein Hausmann?
Was trägt ein west-östlicher Dandy? Und warum sind reiche Männer selten schön? Eigene Vorurteile werden hinterfragt, Kindheitserinnerungen geweckt und Modetrends auf die Spitze getrieben. So war die Kleidung von Obdachlosen Vorbild für die abgewetzten Looks vieler bekannter Designer, wie John Galliano, Vivienne Westwood oder Patrick Mohr.
HFBK-Student Harm Coodes hingegen lässt sich in seiner klaren Kollektion „Niemals allein, immer einsam“ von Emotionen der sozialen Außenseiter leiten. Eine am Bauch viel zu weite Hose symbolisiert schlicht Hunger. Dem Hamburger Textem Verlag sei Dank, dass diese bereichernde Sammlung frischer, tiefschürfender Gedanken jetzt jeder erstehen kann, solange der Vorrat von 1.500 Stück reicht.
Anette Geiger, Kai Lehmann, Ursula Zillig: „Der schöne Mann. Das Magazin“, Textem Verlag, 292 Seiten, 14 Euro
ALI, Szene Hamburg, Februar 2012
Carsten Klook: Ein Mann, viel Kunst

Eine Wasserleiche spielt eine große Rolle in Carsten Klooks neuem Buch "Stadt unter". In Lauenburg wird sie aus dem Fluss gefischt. Wieso sie den Drehbuchautor Marc schier zur Verzweiflung treibt, erfahren Besucher heute Abend ab 20 Uhr im Café Mondmann. Dort liest Carsten Klook auf Einladung von Professors Pierangelo Maset von der Leuphana Universität in der Reihe "Kunst und Pop".
"Ich habe in dem Roman Krimi-Klischees hochgenommen. Der Drehbuchautor Marc der unbedingt einen Krimi abliefern will, hat nur diese kleine Idee mit der Wasserleiche, doch dann verheddert er sich immer wieder und die Geschichte dekonstruiert sich selbst", sagt der Hamburger Autor. Aber nicht nur ein Kriminalfall und ein Autor, der sich mit einer Schreibblockade herumplagt, finden in dem Text Platz. Es bleibt auch noch Raum für eine Liebesgeschichte und die wiederum nimmt Einfluss auf den Verlauf der Krimihandlung.
An dem Ort der Handlung, in dem kleinen Städtchen Lauenburg, kennt sich Carsten Klook gut aus. Dort war er vor einigen Jahren Stipendiat im Künstlerhaus. Anders als in seiner Heimatstadt Hamburg war es für den 52-Jährigen in Lauenburg leicht, sich auf die Schriftstellerei zu konzentrieren. "Neben dem Austausch mit anderen Künstlern, war der Blick auf die Elbe einfach großartig. Damit muss man erst einmal klar kommen, mit dem ganzen Wasser." Viele gute Ideen seien ihm draußen, auf der Terrasse, meistens jedoch in Flussnähe gekommen.
Auf einer Veranstaltung in Lauenburg sprach ihn schließlich auch Professors Pierangelo Maset an und lud ihn ein, Studierenden sein Buch vorzustellen. Immer wieder bitten die Lüneburger Wissenschaftler Menschen, die im Kulturleben als Galleristen, Verleger, Übersetzer, Künstler oder Schauspieler aktiv sind, etwas über ihre Arbeit zu erzählen. Beleuchtet werden sollen Lebensmodelle und Strömungen, gerne auch abseits des Kunst-Mainstreams. Carsten Klook hat sich bisher künstlerisch auf sehr vielen verschiedenen Feldern ausprobiert und ist damit prädestiniert über Anknüpfungspunkte zwischen Kunst und Pop zu sprechen. Der Hamburger war schon immer kreativ: in den 80er- und 90-er Jahren schrieb der Journalist und Autor Musikkritiken. Später erarbeitete er selbst Hörspiele und Audio-Collagen. Im Lauf der Jahre hat er vier CDs veröffentlicht und für Radio Bremen das Hörspiel "Die Reise nach Worpswede" realisiert.
Auch im Schreiben und Zeichnen fühlt sich Klook zu Hause. Unter anderem für die Wochenzeitung Die Zeit hat er Literaturkritiken geschrieben. Aber auch eigene Texte hat er verfasst. Eine Figur aus seinem ersten Roman "Der Korrektor", das im Jahr 2005 erschienen ist, spukte ihm besonders lange im Kopf herum. Schließlich wurde sie im aktuellen Texte neu verarbeitet. "Das war so ein Kriminalkommissar, wie man sich ihn vorstellt. Und es macht Spaß, mit solchen Klischeefiguren zu spielen", sagt der Schriftsteller. Genregrenzen interessieren ihn dabei nicht besonders.
Gute Ideen schon. Und davon hat Carsten Klook viele. Anschaulich zu bestaunen sind einige davon in dem Buch "Tattoovorschläge für Headbanger und Bedhanger", das im Ausnahmeverlag erschienen ist. Delfine, Rosen, Tribals und andere Tattoo-Motive, die hunderttausendfach auf Waden, Steißbeinen und Oberarmen durch Deutschland getragen werden, sind darin nicht zu sehen. Er habe möglichst abwegige Vorschläge für den Langzeit-Körperschmuck gesucht, sagt Klook. Wer seinen Vorschlägen folgt, kann sich den durchsichtige Stoiker auf Partnersuche oder den leise nörgelnden Eremiten in die Haut stechen lassen und sich einigermaßen sicher sein, dass er das Motiv exklusiv hat. Mitgeliefert wird ein Stück fleischfarbene Folie mit Haar, um zu sehen, wie sich die kleinen Kunstwerke auf Haut ausnehmen.
Heute sieht er sich in erster Linie als Autor, auch wenn er nicht ausschließen könne, dass noch einmal ein Gitarrenalbum von ihm erscheint, sagt Carsten Klook lachend. Gestern hat er hat die Textstellen ausgesucht, die das Publikum heute Abend zu hören bekommt. Aufgeregt ist er nicht. Aber gesundes Lampenfieber hat er doch.
Die Lesung heute im Lüneburger Café Mondmann, Lünertorstraße 20, beginnt um 20 Uhr, der Eintritt ist frei. Das Buch "Stadt Unter" ist im Textem Verlag erschienen, 178 Seiten, 14 Euro
Hamburger Abendblatt 26. Januar 2012
Radiobeitrag zum "Schönen Mann" im MDR 25.01.2012
Männer-Magazin

»Herrenmode darf eigentlich nicht schön machen, denn Männer fürchten die Schönheit. Nur, was sollten sie dann darstellen?« Diese und andere Fragen um Männer, Schönheit und Mode versuchen Studierende des Integrierten Designs an der Hochschule für Künste Bremen in ihrem Magazin »Der schöne Mann« zu beantworten. Entstanden ist ein hübsches Bilder- und Lesebuch für Schöngeister. Zu sehen gibt es Bilder von fünfzehn eigens entworfenen Kollektionen, zu lesen ein pointiertes Mode-ABC, Interviews mit Designern, Essays beispielsweise vom Philosophen Wolfram Bergande und von der Kunst- und Kulturwissenschatlerin Annette Geiger. (rud.)
Der schöne Mann - Das Magazin, Texten Verlag 2012
Neue Zürcher Zeitung, 23. Januar 2012
LEIBHAFTIG
Man mag zweifeln, ob es sich beim „Zweifel“ tatsächlich um eine Stimmung handelt und nicht viel eher um eine Haltung, mithin um eine willentlich und bewusst eingenommene Einstellung. Während Stimmungen meist diffus aufs Gemüt ein- und nicht selten hinter unserem Rücken fortwirken, ist ein Akt wie der „Zweifel“ zweifellos bewusst. Wer zweifelt weiß, dass er zweifelt. Ob er auch weiß, dass er denkt und ergo ist, wie weiland der notorische Zweifler Descartes dem hochgelehrten Publikum glauben machen wollte, sei dahingestellt. Klar aber ist: Stimmungen überkommen, ja überfallen uns, Haltungen nehmen wir ausdrücklich ein.
Aber vielleicht wäre das ein Streit um Kaisers Bart. Und man muss nicht gleich mit Heideggers „Stimmung“ als Stimmungskiller daherkommen, um Idee und Projekt des Textem-Verlags schlicht zu bewundern. Seit 2011 bringt er in unsortierter Reihenfolge in kleinem Format, aber mit großer Chuzpe die Enzyklopädie „Kleiner Stimmungs-Atlas in Einzelbänden“ heraus, wo von A wie „Angst“ oder „Albernheit“, über L wie „Laune“ oder P wie „Passivität“ ein Alphabet von Stimmungen erscheint, das weniger auf intellektuelle Begriffskunde zielt als auf die stets riskante Befragung der je eigenen Gegenwart. Verantwortet von Jan-Frederik Bandel und Nora Sdun, könnte man die Reihe getrost als eine Art Gegengift gegen jene „Realitätsverkennung“ lesen, die den befällt, der den Dingen entweder zu nahe rückt oder ihnen zu fern bleibt.
Erstes wäre dem atemlos Umtriebigen geschuldet, letzteres dem spröden Academicus. Wer also Stimmungen anvisiert, braucht vorab ein Gespür für den richtigen Abstand und ein Timbre, das verbindlich in der Sache, doch zugleich geschmeidig ist. Auf den Ton kommt es an. Und den hat Stefan Ripplinger vorzüglich getroffen. Sein Essay über „Bildzweifel“ ist eine blitzgescheite Miniatur über eine Attitüde, die einnimmt, wer zwischen blinder Idolatrie und blindwütigem Ikonoklasmus eine dritte Position auszumachen sucht. Es gilt, das Bild und seine Macht ernst zu nehmen, ohne sich ihr negativ, wie der Bilderstürmer, oder positiv, wie der Bildfetischist, rückhaltlos zu unterwerfen. Bildern wohnt ein Zauber inne, den tückischerweise auch der, der ihn zu brechen begehrt, voraussetzt. Ihre Macht verdanken sie jenem inneren, auf Ähnlichkeit gegründeten Verhältnis, das zwischen Bild und Bildgegenstand am Werk ist, und das eben nicht, wie etwa beim Zeichen, nurmehr äußerlich und arbiträr ist, durch bloße Konvention gestiftet. Bilder machen leibhaftig gegenwärtig, was leibhaftig nicht gegenwärtig ist. Das ist ihre Magie, ihre Macht. Sie ist geliehen, gewiss, dem Bildgegenstand geschuldet; nichtsdestotrotz ist sie beängstigend, faszinierend, ebenso diabolisch wie numinos, im vollen Wortsinne: gewaltig. Der Monotheismus, von Echnaton über Moses bis zu Jesus, Paulus und Mohammed, wusste genau, mit was er es zu tun hatte.
Was die ersten Menschen der Steinzeit empfanden, als einer der ihren mit Holzkohle und Ruß irgendwelche Konturen bei fahlem Feuerschein an einer Höhlenwand nachzog und plötzlich eine „Gestalt“ erschien? Wir wissen es nicht; auch nicht, ob dieser erste Zeichner alsbald eine steile Karriere in seiner Sippe hinlegte oder sein Tun womöglich gar nicht überlebte. Was wir aber wissen ist, dass der Mensch, seitdem er als homo pictor reüssierte, in einer grundlegenden Gefühlsambivalenz dem Bild gegenüber verharrt. Die Geschichte des Bildes ist auch die Geschichte von Ikonoklasmus und Idolatrie, von Bildersturm und –anbetung.
Der Bildzweifel nimmt diese Ambivalenz zwar ernst, entscheidet sie aber nicht, verweigert sich der Eindeutigkeit. Seine Arbeit am Bild, mit und gegen das Bild zielt auf anderes. „Der Bildzweifel“, so der Autor, „ist sowohl von der Idolatrie als auch vom Ikonoklasmus kategorisch unterschieden, denn zwar braucht er das Bild, aber nicht, um es zu verehren oder zu vernichten. Er setzt die beiden Komponenten – Abgebildetes und Abbildung –, die die Verehrung miteinander verklebt hat, sorgfältig voneinander ab. Er trennt sie aber nicht vollständig wie der Bilderstürmer.“
Stefan Ripplinger, Journalist und Mitbegründer der Zeitschrift „Jungle World“, folgt exemplarisch den Spuren des Bildzweifels, dem eine Bildarbeit auf dem Fuße folgt, die nicht erst in der Kunst der Avantgarde – etwa bei Malewitsch oder Rodtschenko, bei Yves Klein, Isa Genzken, Luis Buñuel oder George Grosz – die Grenzen des Bildhaften rigoros austestet. Wie sehr schon die theologische Tradition des Abendlandes von Fragen umgetrieben wurde, die dann die Moderne ästhetisch durcharbeitete, zeichnet das schmale, doch gehaltvolle Bändchen luzide nach. An Marcel Duchamp, einem der sicherlich reflektiertesten Künstler der Moderne, wird zuletzt deutlich, dass man sinnvoll nur mit Bildern an Bildern zweifeln kann. „Der Bildzweifel will sich des Bildes nicht entledigen, er braucht es. Das Bild ist, gerade weil es schwach ist, sein Weg in die Welt.“
Stefan Ripplinger: „Bildzweifel. Reihe: Kleiner Stimmungs-Atlas in Einzelbänden“ Textem Verlag, Hamburg 2011. 85 Seiten. ISBN 978-3-941613-82-9. EUR 12
Michael Mayer, artnet, 20. Januar 2012
Die Kunst der Albernheit

“Hör auf damit, wir müssen seriös wirken!” – Was das weite Feld der Kunst angeht, sei es zeitgenössisch oder historisch, begegnet man den Werken stets mit einer gewissen Strenge und Ernsthaftigkeit. Wird es albern, werden Augenbrauen in die Höhe gezogen und Mundwinkel verzogen – Kunst hat nicht albern zu sein! Dabei ist gelegentliches Rumblödeln doch durchaus nützlich für den künstlerischen Prozess, erklären Michael Glasmeier und Lisa Steib in ihrer Abhandlung “Albernheit“. Diese reiht sich in den “Kleinen Stimmungsatlas in Einzelbänden” des Textem Verlages ein.
“Albernheit ist unberechenbar. Als Einzelgängerin im Feld des Komischen macht sie sich verdächtig, kennt sie doch weder Grund noch Ziel. Mit ihrem vermeintlichen Gegenspieler, dem Ernst der Lage, verbündet sie sich, um am Rand der Erschöpfung unbemerkt ihren Einsatz vorzubereiten. Erbarmungslos, plötzlich und in aller Unangemessenheit schlägt sie zu, wenn das Opfer es am wenigsten erwartet.”
Jeder kennt diese Situation: Lachen wäre jetzt wirklich ziemlich unangebracht, die Situation erfordert absoluten Ernst. Doch das Kitzeln wird immer stärker, nur mit aller Kraft lässt sich der Ausbruch noch unterdrücken – bis es schwallartig aus einem herausprustet, das Kichern und Lachen. Diesem Phänomen, welches im Gegensatz zum gepflegten, vorzeigbaren Salonhumor so gar keinen Anstand hat, gehen Glasmeier und Steib in ihrem höchst lesenswerten Essay nach.
Angewandte Situationskomik
“Vom Charakter der Albernheit”, “Methoden der Albernheit” und “Angewandte Situationskomik” heißen die Kapitel unter anderem, die nach verstaubter, wissenschaftlicher Abhandlung klingen und doch soviel Sprachwitz beinhalten, der seinerseits allerdings nie ins Alberne abrutscht.
Besonderes Augenmerk richten die beiden Autoren auf das Thema der Albernheit in der Kunst: Nur selten nehmen sich Künstler und Künstlerinnen die Freiheit, einmal herrlich sinnfrei herumzublödeln. Passiert es doch, so stehen Kunstkritiker, Galeristen und Kuratoren zur Stelle, die dem Kunstwerk bereitwillig eine verkopfte Theorie anheften.
Nicht immer funktioniert diese Strategie allerdings: Bei der 1979 enstandenen “Wurstserie” von Peter Fischli & David Weiss handelt es sich um abfotografierte Alltagsszenen zwischen sauren Gürkchen, Rettichstücken und Wurstaufschnitt. Eine Arbeit, die zwar in jedem Text über das Duo erwähnt, aber selten ausführlicher besprochen wird, da sie “dem Ergebnis eines kindlichen Spiels näher als einer andeutbaren künstlerischen Strategie” stehen, heißt es.
Doch bereits die Dadaisten verstanden sich auf die Kunst des albernen Humor, ebenso hatten Paul Klee, Marcel Duchamp und Alexander Calder (mit seinem berühmten Zirkus) ihre Momente. Mit seinen “One Minute Sculptures” und der Aufforderung an die Museumsbesucher, sich mitunter leere Plastikeimer auf den Kopf zu setzen, bildet Erwin Wurm ein prächtiges Beispiel dafür, dass Albernheit auch heute noch in der Kunst zu finden ist. Doch es könnte mehr sein, beschließen die Autoren: Vielleicht könnte es gerade “die Albernheit sein [...], die jene verloren gegangene Potenz der Künste in der leeren Grazie der Grundlosigkeit wieder erwecken könnte”?
In der Reihe “Kleiner Stimmungs Atlas in Einzelbänden” sind bereits erschienen: “A – Angst”, “A – Albernheit”, “B – Bildzweifel”, “V – Verkrampfung” und “M – Modernität”.
Michael Glasmeier, Lisa Steib, Kleiner Stimmungs Atlas in Einzelbänden. A – Albernheit, Textem Verlag, Frankfurt a.M 2011, broschiert, 127 Seiten, 12 Euro. ISBN 978-3-938801-77-2
Kunst Magazin am 18. Januar 2012 von Julia Schmitz
Der schöne Mann im Deutschlandradio 13.01.2012
Der schöne Mann

Wie »Der schöne Mann« aussieht, wollen wir natürlich alle wissen. Ein gerade erschienenes, gleichnamiges Magazin versucht Antworten zu geben.
Darf Mode Männer eigentlich überhaupt schön machen oder sind sie dann keine »echten« Männer mehr? Eine der Fragen, um die es in Essays, Fotostrecken und Interviews in diesem von Studierenden des Integrierten Designs an der Hochschule für Künste Bremen erarbeiteten Magazin geht. Niemand geringerer als Joachim Baldauf übernahm die Art-Direktion Fotografie für »Der schöne Mann«, das an der Hochschule entworfene Kollektionen auf Fotos von Studenten zeigt. Dazu kommen Texte über Themen wie »Die Schönheit des Antihelden«, »Die Auferstehung der Brustbehaarung« oder »Don Drapers konstruierte Männlichkeit in der Serie ›Mad Men‹«. Die Bildergalerie gibt einen Einblick die interessante Fotoästhetik.
Hg. Annette Geiger / Kai Lehmann / Ursula Zillig, Hochschule für Künste Bremen
Art Direction Fotografie: Joachim Baldauf, Berlin
Art Direction Grafik: Tania Prill, Zürich
»Der schöne Mann – Das Magazin«
ISBN: 978-3-86485-002-8
14,00 Euro
Textem Verlag, Hamburg
17.01.2012 Page: Claudia Gerdes
Interview

Schwan frisst Skript. Hamburger Fernsehdramen
Stadt unter – Carsten Klook
Ein Drehbuchautor hat eine Schaffenskrise und das in Hamburg. Er scheppert sich so durch die Tage und sucht immer noch nach einer Kriminalstory. Dabei lässt er keine Quelle aus, seine Freunde verwandeln sich zu einem Teil der Geschichte, Artikel aus Zeitungen werden gezielt nach möglichen Krimiereignissen abgesucht und hinter jedem Busch vermutet er eine Leiche oder einen Mörder.
So ist das, wenn man verzweifelt ein Drehbuch schreiben muss, das Fernsehen den Termin festgelegt hat, und man eigentlich eher sich verlieben möchte, als an dieser Geschichte nun weiterzubasteln. So fliegt dann das Skript auch aus dem Fenster und wird prompt gefressen von einem Schwan, der auf der Elbe schwimmmt.
Die Versuche gehen dann noch weiter. Wer schon einmal an einer längeren schriftlichen Arbeit gesessen hat, kann das, was da der Hauptperson passiert ist, nachvollziehen.
Ein sehr lebendiger und manchmal auch lustiger, sprachlich oft brisanter Roman, der zunächst als Krimi daherkommt, dann eher Schreibkrise, Liebesgeschichte zum Gegenstand der Erzählung hat.
Carsten Klook lebt als Schriftsteller in Hamburg. Vor Stadt Unter (Titel) erschienen bereits andere Romane von ihm.
Birgit Friebel, Letterbox-Pirilamponews 3. 1. 2012
Das Seufzen der Masken

Eine wundersame, süße Maske fesselte den Blick – wären da nicht diese Spaghetti. Und Häute. Und die Pommes. Was der Hamburger Künstler Dirk Meinzer erschafft, das irritiert. Denn es lebt, irgendwie. Seine Bilder widmen Federn, Zangen, Schwänze um zu Augen, Nasen, Mündern wilder Masken. Ein "ästhetischer Begegnungsprozess mit dem körperlich Anderen", nennt es ein Kritiker. Seine Kunst will uns verleiten, im Bekannten das Fremde zu erkennen. Wir zeigen Bilder aus seinem neuen Band Seufzen II (Textem Verlag).
ZEIT online, Januar 2012
http://www.zeit.de/kultur/kunst/2011-12/fs-dirk-meinzer
