Wie man abschafft, von dem man spricht
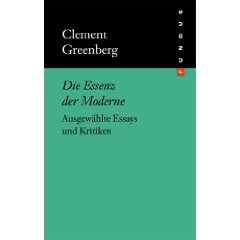
Kunstzentren ziehen – anders als Galerien – nicht einfach eben mal so um. Manchmal braucht es die Erschütterungen eines Zweiten Weltkriegs, um eine Neuordnung zu definieren. Als der amerikanische Kunstkritiker Clement Greenberg im Januar 1948 in „The Nation“ von der Überlegenheit der modernen amerikanischen Kunst sprach und damit die Vormachtstellung der „École de Paris“ und damit Europas dementierte, ging das, so der Kunstgeschichtler Serge Guilbaut, wie „eine Bombe“ hoch.
Natürlich war Greenbergs Affront Kalkül, aber man musste schon zugeben, dass sich die amerikanische Kunst der letzten zwei Jahrzehnte von ihren Provinzialismen erfolgreich befreit und Anschluss an die moderne Kunst gefunden hatte. Im Gegenzug erschien Greenberg die vor allem französische Kunst verbraucht. Hier herrschte allenthalben Erstarrung und Akademismus, eine Kategorie, die Greenberg als Kritiker moderner Kunst nur als Schimpfwort gebrauchen konnte. Denn für ihn bedeutete Kunst, speziell moderne Kunst, nicht nur – und schon gar nicht in erster Linie – Virtuosität, Übung, Können, sondern vor allem die Entwicklung eines Konzepts, wie es in der Kunst an genau der Stelle, wo ein Künstler angekommen war, weitergehen könne. (Hier und nur hier trifft sich Greenberg mit Adorno: der Gedanke der Avanciertheit des Materials, was auch immer das ist.)
Das entscheidende Konzept, das Greenberg in seiner mittleren Schaffensperiode in diesem Zusammenhang einbringt, ist das des Mediums. Auf den ersten Blick hat es den grandiosen Vorteil, sowohl sich historisch „deduzieren“ zu lassen, als auch eine Wesensbeschreibung moderner Kunst zur Verfügung zu stellen. Denn auf der einen Seite präsentiert sich moderne Kunst als logischer Schritt auf dem Entwicklungsweg von Kunst überhaupt, auf der anderen Seite kommt die Kunst in ihrer modernen Form, so will es scheinen, überhaupt erst zu sich selbst. Die Frage stellt sich natürlich, warum Kunst so lange dafür gebraucht hat, um – und das ist der Punkt – die Gegenständlichkeit und die Besetzung der Bildoberfläche mit „Inhalt“ hinter sich zu lassen. Haben die Künstler vor der Moderne das Medium falsch eingeschätzt oder es missachtet? War den Malern der Renaissance und aller späteren Zeitalter bis um 1860 nicht klar, dass, um ein Bild zu malen, es weiter nichts brauchte als die Oberfläche der Leinwand und Farben, um diese in einer gewissen Anordnung darauf zu platzieren?
Nach Clement Greenberg beschreibt die Kunst der Moderne einen unaufhaltsamen Prozess der Bereinigung. Was nicht notwendigerweise zum Medium der Malerei gehöre, habe keinen Platz auf einem Bild. Nur, was gehört zum Medium? Bloß das, was die Eigenlogik der Malerei definiere, und dazu gehören, ganz in der Tradition des katholischen Malers Maurice Denis, der sich selbst gar nicht an seine eigene Formulierung gehalten hat, die „plane Oberfläche“ des Bildes und „Farben, die in einer bestimmten Anordnung zusammengefügt sind“. Denis konnte ja dann immer noch ein Schlachtross oder eine nackte Frau bewundern, aber diese Dinge sind für Greenberg ein für allemal passé. In dem Moment, in dem ein Maler oder eine Gruppe ein bestimmtes neues Niveau definiert haben (nur, wie tun sie das?), kann man als Maler, der am Erhalt des Qualitätsniveaus in der Malerei interessiert ist, nicht mehr hinter das gerade Erreichte zurückfallen. Avantgarde verpflichtet. Nun aber kommt die Geschichte mit dem Zauberlehrling ins Spiel. Denn ein radikal gedachter, immer weiter gehender Selbstpurifikationsprozess brächte sie – also die Malerei – zum Verschwinden (und das passierte ja auch genau). Denn am Ende steht ein Stück Leinwand und ein Farbeimer rum. Und so weit war schließlich Marcel Duchamp auch schon, nur ein paar Jahrzehnte früher (und er argumentierte sehr lustig: „Da die Farbtuben, die der Künstler verwendet, fabrizierte Fertigprodukte sind, müssen wir schließen, dass alle Bilder der Welt assisted Ready-mades und auch Assemblagen sind.“).
Greenberg hat das Konzept des Mediums später aufgegeben, es taucht nicht mehr auf. Statt dessen zieht er sich, der schon immer einen elitären Standpunkt vertreten hat (auch und vielleicht gerade als Trotzkist) auf das durchaus Kantische Geschmacksurteil zurück, das es erlaube, zwischen guter und schlechter Kunst zu unterscheiden, so die neue Opposition. Es seien im Grunde nur ganz wenige, die es überhaupt aufgrund ihrer jahrelangen Beschäftigung mit (moderner) Kunst fertig brächten, etwas Sinnvolles darüber zu artikulieren. Und die, die das könnten, wären alle einer Meinung, jenseits des analytischen Arguments. Was aber, das muss man dann doch fragen, ist das überhaupt für eine absurde Veranstaltung, die (moderne) Kunst? Das Spektakel für die Masse, die Geheimwissenschaft für die „Wissenden“? Das klingt schon wieder sehr europäisch, sehr nach Guy Debord, den Revolutionsscharlatan par excellence.
Manches von dem, was Greenberg später theoretisch ins Spiel bringt, ist schon damals nicht recht anschlussfähig gewesen, so die Rede von „formalisierter Kunst“ (das ist definitiv ein re-entry zu viel) – ein Terminus, der konturiert wird durch die das Lancieren von „roher Kunst“ (etwa Duchamps „Flaschentrockner“). Duchamp würde sagen, Greenberg sei noch zu sehr mit der „Netzhaut“ beschäftigt gewesen. Im Übrigen ist Duchamps „Fountain“ keine Rohkost. Sondern eben ein sehr avancierter Vertreter (als sein eigener Gründungsmaschinist) des Kunstverständnisses, das ja auch Greenberg angeblich unterstützt: das der konzeptuellen Kunst. Greenberg liefert teilweise sehr subtile Analysen (zum Beispiel in dem Artikel „Collage“), aber insgesamt hat man als Leser den Eindruck, mit einem recht esoterischen Bereich zu tun zu haben. Als der Hype um die Kunst richtig los ging, hatte Greenberg nicht mehr viel zu sagen. Ein anderer Karl Kraus, den die Geschichte eingeholt hat.
Dieter Wenk (07-09)
Clement Greenberg, Die Essenz der Moderne. Ausgewählte Essays und Kritiken, herausgegeben von Karlheinz Lüdeking, aus dem Englischen von Christoph Hollender, Hamburg 2009 (Philo Fine Arts), Fundus 133