Vom Zauberwürfel am Fuße der Klippen
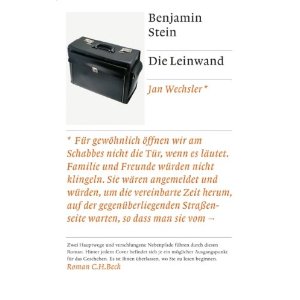
Klippensurfen ist gefährlich. Denn an Klippen bläst einem nicht nur ein unsäglicher Wind um die Ohren, sondern es entsteht auch ein nahezu unwiderstehlicher Sog namens Neugier, der einen immer näher an den Abgrund führt, nur um einen Blick auf dessen Boden erhaschen zu können. Die Gefahr des Abrutschens ist immer dabei, der Klippensurfer ist sich dessen bewusst. Dennoch kann er nicht anders. Von seiner Neugier und dem pochenden Adrenalin in seinen Adern angetrieben setzt er einen Fuß vorsichtig vor den anderen und nähert sich mit seltsam gestrecktem Oberkörper und leicht nach vorn geneigtem Kopf der möglicherweise verhängnisvollen Kante. Es berauscht, was unter dieser Kante rauscht.
Wie ein Klippensurfer fühlt sich auch der Leser von Benjamin Steins „Die Leinwand“. Die Klippen, an dessen Kanten er surft, sind die Buchdeckel, die diesen Roman zwar umfangen, aber nicht einfangen können. Es fängt damit an, dass man dieses Buch nicht einfach vorn aufschlagen, bis zur letzten Seite durchlesen und dann wieder zuschlagen kann, denn es gibt weder eine unzweifelhaft erkennbare erste noch eine finale letzte Seite. Es gibt allenfalls Möglichkeiten, mit der Lektüre anzufangen und aufzuhören. Denn Benjamin Steins Roman ist in zwei Geschichten geteilt, die beide aufeinanderzulaufen, von jeweils einem Buchdeckel zur Mitte hin, wo sie … ja, wie nennt man das? Kadenzieren? Kulminieren? Kollidieren? All das trifft irgendwie zu, auch wenn es nicht einander entspricht.
Den Nagel auf den Kopf trifft es nicht, denn das, was in der Mitte dieses Buchs geschieht, ist bisher einmalig in der Literaturgeschichte. Es findet eine Grenzüberschreitung sondergleichen statt, über die Grenzen des Genres, der Buchdeckel und der Handlung hinweg hinein in die subjektive Realität des Autors und des Lesers. Denn mit der Lektüre einer der beiden finalen Seiten beginnt erst das, was man den Hall des Romans nennen könnte. Als hätte Stein seinen Roman akustisch in das Tal unseres Daseins geschrieben, hallt der verstörende und aufwühlende Inhalt dieses Romans von allen Wänden der eigenen Existenz wieder.
Als Leser hat man also die Wahl, ob man lieber mit der Lebensgeschichte des jüdischen Psychoanalytikers Amnon Zichroni beginnen oder besser mit der Erzählung des Journalisten Jan Wechsler starten möchte. Wer nun aber meint, er hätte damit die Handlung im Griff oder könnte vielleicht sogar ihren Verlauf beeinflussen, der erliegt einer Täuschung. Die Handlung des Romans ist kaum einzufangen, denn sie entzieht sich aufgrund ihrer inneren Struktur immer wieder der Kontrolle. Beide Geschichten sind sowohl Teil der anderen Erzählung als auch von dieser völlig losgelöst. Das Lesen dieses Romans ist daher wie das Spiel mit einem Zauberwürfel, bei dem jede Drehung das gesamte Verhältnis der 54 Quadrate zueinander, aber auch das der Quadrate innerhalb der einzelnen Farbfelder verändert. Wer also literarische Experimente scheut, wird sich möglicherweise etwas schwer mit diesem lesenswerten Zauberwürfel tun.
Aber es lohnt, sich auf ein besonderes Spiel einzulassen, welches dieser Roman ermöglicht: das Lesen der beiden Geschichten im Wechsel. Auch in dem Fall hat man die Wahl, ob Zichroni oder Wechsler das erste Wort haben, aber danach eröffnet sich eine kongenial strukturierte Romanlandschaft, die hier in Anlehnung an die weit verbreiteten bunten Kinderbausteine legoisch genannt werden soll. Dabei entspricht jedes Kapitel einem Legobaustein, die, abwechselnd gelesen und im Versatzsystem aufeinander gestapelt, nichts anderes als ein nahezu unzerstörbares System an Inderdependenzen ergeben. Nur durch das Ineinandergreifen geben sie dem Roman ein zusätzliches inhärentes Gerüst. Und ebenso sind die abwechselnd gelesenen Zichroni- und Wechsler- bzw. Wechsler- und Zichroni-Kapitel legoisch miteinander verbunden. Sie vereinnahmen Aspekte der jeweils anderen Geschichte, mal recht deutlich, mal allenfalls subtil. Es entstehen kapitel- und erzählungsübergreifende Kohärenzen, die für sich eine Art Tiefengrammatik dieser Doppelerzählung darstellen. Doch je weiter die Geschichten ihrem Ende entgegenlaufen, desto unterschwelliger werden diese Übernahmen. Konnte man dieses Hin und Her, den Wechsel der Perspektiven anfangs noch mit T.C. Boyles „América“ vergleichen, wird dies im Verlauf des Romans immer unmöglicher, denn bei Boyle laufen die beiden Erzählstränge aufeinander zu. Bei Stein aber scheinen sich die Erzählungen voneinander zu entfernen. Die Fragezeichen im Kopf des Lesers, der rätselt, wie diese Geschichten zusammengehen sollen, werden von Kapitel zu Kapitel eher größer statt kleiner – eine weitere kongeniale Absurdität dieses Romans. Während sich die Kohärenzen zwischen den Kapiteln zunehmend auflösen, bleiben die Zusammenhänge in der Tiefenstruktur des Romans erhalten. Linguistisch gesprochen müsste man sagen, dass die Kohärenz wird von der Kohäsion abgelöst wird. Und so funktioniert dieser Roman wie ein Zauberwürfel, bei dem man auf allen Seiten zugleich denken und drehen, die kleine Struktur ebenso wie die große im Auge behalten muss, um am Ende die richtigen Farben beieinander zu haben.
Benjamin Steins „Die Leinwand“ besitzt aber nicht einfach nur die genialistisch verwirrendste Erzählstruktur dieses Bücherjahres, sondern ist zugleich eine einzigartige Doppelerzählung, die man dem Wesen nach den Genres der Grusel-, Erkundungs- und Entdeckungsliteratur zurechnen müsste. Es gibt zwei Ausgangspunkte, aber kein Ende. Es existieren viele Wegmarken, aber kein sicherer Grund, auf dem man laufen könnte. Darüber hinaus wimmelt es in diesem Buch von Geistern – der der Vergangenheit und der der eigenen (Steins und der des Lesers) Identität. Es wimmelt in der „Leinwand“ an autobiografischen Verweisen, sei es in Wechslers DDR-Familien-Ruderer-Biografie oder in dem psycho-pathologischen Interesse des jüdisch-orthodoxen Zichroni. Mit beiden Figuren ist zugleich auch Stein gemeint, ihrer beiden Geschichten ergib irgendwie die seine – nicht streng chronologisch, sondern spielerisch legoisch. Und wo das System der Plastebausteine an seine Grenzen gerät, um den Zugang zu Benjamin Steins Biografie herzustellen, greift die Magie des Zauberwürfels. „Die Figur ist der Erzähler“, schreibt Stein in seinem „Turmsegler“-Blog über seinen speziellen Stil, „nicht Wahrheit beanspruchend, was die erzählte Welt angeht. Wohl aber Wahrhaftigkeit.“ Objektive Realität gibt es in seinem Erzählkosmos nicht, sondern nur noch subjektive Wirklichkeit, erlebtes Leben. „Ich bin, woran ich mich erinnere. Etwas anderes habe ich nicht.“, sagt Wechsler inmitten seiner Erzählung verzweifelt, als seine Welten verschwimmen und er nicht mehr weiß, „was wahr und was Lüge ist.“
Dieses Problem haben alle Figuren in Steins Roman. Egal ob Zichroni oder Wechsler oder aber der Geigenbauer Minsky, der in beiden Wirklichkeiten eine wichtige Rolle spielt, sie alle werden verfolgt. Verfolgt von ihrer Vergangenheit versuchen sie sich dieser nach vorne fliehend zu stellen und kreieren sich in ihren Erinnerungen ihre subjektiven Wirklichkeiten. Doch Erinnerungen sind wacklige Gefährten. Jan Wechsler muss dies auf bittere Weise erfahren, denn sein fehlendes Gedächtnis führt nicht nur zum Zusammenbruch seiner Ehe, sondern bedroht ihn existenziell. Ein gewisser Jan Wechsler, offensichtlich eine zufällige Namensdoppelung, hat vor Jahren das Leben zweier Menschen zerstört, die des Psychologen Amnon Zichroni und die eines seiner Patienten, des Geigenbauers Minsky. Minsky hatte auf Anraten Zichronis seine Lebenserinnerungen, die eines Holocaust-Überlebenden in Polen, aufgeschrieben. Wechsler aber entlarvt Minsky als Hochstapler, was Minskys Holocaust-Prominentenstatus beendete und außerdem zum Entzug der Approbation Zichronis führte. Während sich Minsky in ein Schweizer Dorf zurückzieht, verschwindet Zichroni wie vom Erdboden. Wechsler wird nun mit dieser Geschichte konfrontiert, kann sich aber daran nicht an diesen Skandal erinnern. Er versucht, der Geschichte auf den Grund zu gehen, seine Unschuld an diesem Drama zu beweisen, doch je mehr er sich mit der Sache auseinandersetzt, desto tiefer sind die Widersprüche, die aus seinen subjektiven Wahrheiten hervorgehen. Oder anders gesprochen: Je näher er an den Abgrund der eigenen Vergangenheit tritt, desto wahrscheinlicher wird sein Absturz. Zichronis Rückblicke hingegen rekapitulieren die Gespräche mit Minsky und dessen Memoiren eines Holocaust-Überlebenden, um dann den Vernichtungsfeldzug „der Journalisten, die über uns herfielen, wie eine Meute Ratten“ zu sezieren. Beide schwimmen durch die an sie herangetragenen Ungerechtigkeiten und erkunden dabei ihr Spiegelbild, in das sie zu schauen gezwungen sind.
Wechsler und Zichroni setzen sich mit ihren Erinnerungen auseinander, als müssten sie sich darin selbst erst einmal finden. Und irgendwo in oder zwischen diesen beiden erinnerten Biographien existiert die autobiografische Erinnerung Benjamin Steins, ohne dass man eine genaue Trennlinie findet, wo hier die biografische Auto-Psychoanalyse des Schreibers beginnt und wo die Fiktionalisierung seines eigenen Ich’s in fantastische Erzählung übergeht. Die Randdaten seiner Figuren finden sich auch in seiner Vita wieder. Benjamin Stein kommt aus einer jüdischstämmigen Familie, im Leben seiner Eltern spielte die jüdische Religion aber keine Rolle. Schon früh viel Stein in der DDR als Leser unbeliebter Prosa auf. Nach der Wende studierte er Judaistik und Hebraistik in Berlin. 1995 schrieb er mit „Das Alphabet des Juda Liva“ einen sensationellen Debütroman, legte aber direkt danach die Belletristik zur Seite und war als Redakteur für verschiedene Technik- und PC-Magazine tätig. Zugleich entdeckte er die Religion seiner Familie wieder, besuchte die Synagoge in der Berliner Rykestraße im Prenzlauer Berg und konvertierte zum Judentum. Mit dieser religiösen Wende und der des Jahrtausends gründete er eine Wirtschaftsberatungsfirma. 2001 bis 2003 sind die Jahre der Familiengründung, in denen er heiratet und seine Tochter sowie sein Sohn geboren werden. Erst 2007 wendete er sich wieder aktiv der Literatur zu, zunächst als Blogger, dann als Herausgeber der Literaturzeitschrift „spa_tien“. 2008 übernimmt er den Autorenverlag Edition Neue Moderne. Und dann kommt Anfang dieses Jahres dieser umwerfende Roman, dieses autobiografische Geisterbuch in Gestalt eines jüdischen Identitätsromans, in dem sich Benjamin Stein nebenbei im Stile der spielerischen Ironie eines Philip Roth mit den Neurosen und Spleens des auserwählten Volks in der Diaspora auseinandersetzt. Zuviel für die Lebensgeschichte einer Romanfigur, so dass Benjamin Stein seine Biografie auf zwei Lebensgeschichten aufgeteilt hat.
Der gläubige Psychologe Amnon Zichroni und der technisch versierte Journalist und Autor Jan Wechsler, beide schauen in ihre Erinnerungen, wie in einen in tiefer Nacht daliegenden See, in dem sich das Universum ihres Lebens spiegelt. Und mit ihnen blickt der Leser in diese dunkle Unendlichkeit, die gleichzeitig auch irgendwie die von Benjamin Stein und die eigene ist. Zu viert schauen sie in dieses tiefe Schwarz ohne genau zu wissen, ob sie auf den Grund des Gewässers oder in die unendlichen Weiten des sich darin spiegelnden Universums blicken, in denen vielleicht doch eine irgendwie geartete, objektive Wahrheit verborgen liegen könnte.
Diese intensive Erzählung lässt den Leser auch noch lange Zeit nach der Lektüre nicht los. Sie wirkt nach und (ent-)führt in die Welt des Turmseglers Benjamin Stein. In seinem gleichnamigen Blog kann man den (Un-)tiefen dieses Buch oder – literarisch gesprochen – dem „Stein“ in der „Leinwand“ nachspüren. Hier findet man die Pfade wieder hinauf auf die Klippe, die man zuvor während der Lektüre dieser unheimlich packenden Parabel um die Suche nach dem eigenen Ich hinabgestürzt und auf dem Boden wundersam verwunde(r)t aufgeschlagen ist. Einzige Gefahr: Der leidenschaftliche Klippensurfer in jedem Leser erhält einen neuen Reiz, um wieder möglichst nah an den Abgrund zu treten und zu schauen, wo er herkommt und ob dort immer noch dieser magische Kubus liegt, den er dort zurückgelassen hat. Und dann tastet man sich noch einmal nach vorn, an die verhängnisvolle Klippe, stürzt noch einmal herunter und liest diesen großen Zauberwürfel-Identitäts-Vergangenheits-Roman gleich noch einmal. Oder zweimal. Lesevariationen eingeschlossen.
Thomas Hummitzsch
Benjamin Stein: Die Leinwand. Verlag C.H.Beck. München 2010. 416 Seiten. 19,95 EUR, ISBN: 3406598412.
Weitere Besprechung zum Buch von Guido Rohm: textem.de/2087.0.html