Die letztgültige Wahrheit
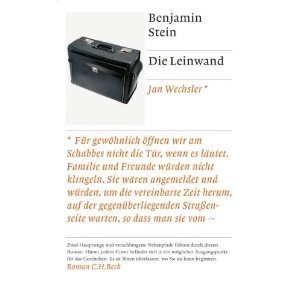
Eine Erinnerung
Wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, dann habe ich den Roman „Die Leinwand“ von Benjamin Stein gelesen. Ich sitze (jetzt und hier in diesem Schreibaugenblick, der mit jedem Buchstaben ein Stück mehr zur Vergangenheit wird) vor der Tastatur - einen Cappuccino zu meiner Linken - und versuche, mich in die Lesesituationen zurückzuversetzen; das ist nicht ohne Gefahren, erliegt man doch schnell dem Trieb, die Momente, die im Rücken der Zeit liegen, zu verklären.
Ich meine, mich erinnern zu können, dass Steins Roman mit den Möglichkeiten der Erinnerung spielt. Erinnerung ergibt Identität. Wenn aber die Erinnerung ein Flickwerk aus Tatsachen und Fantasien ist, manchmal vielleicht nur aus Fantasien, was bleibt dann von der Identität übrig. Wer sind wir wirklich, wenn wir uns nicht auf unsere Erinnerung verlassen können?
Der Roman erzählt von zwei Protagonisten, Ammon Zichroni und Jan Wechsler, er erzählt zwei Geschichten, die ineinanderfließen und sich durchdringen, er ist wie eine Münze mit einer Vielzahl von Seiten. Man liest, was Jan Wechsler uns zu erzählen hat, dann wendet man das Buch (welch eine herrliche Spielerei, welch ein Spiel mit der Identität von Buchcovern. Da gerät die Erinnerung schnell durcheinander. Las ich hier oder bereits hier?) und liest über Ammon Zichroni und seine Sicht der Geschichte.
Jan Wechsler lebt in einer Welt, die ihm keine Sicherheiten mehr bietet. Er bekommt einen Koffer zugestellt, von dem er sich (nur) sicher ist, dass er ihm nicht gehört. Er wird mit einem Autor gleichen Namens verwechselt; zumal einem Autor, der mit einem Buch die Lebens-Geschichte und Holocaust-Erinnerung des Geigenbauers Minsky mit einem Veröffentlichungshandstreich vom Tisch des allgemeinen Mit-Leidens und der Mit-Empörung wischt. Seine Welt gerät ins wanken. Wuchs er in Ostdeutschland auf oder in der Schweiz? Schließlich begibt er sich zu einer – wie er hofft – klärenden Reise nach Israel. Dort wird er verhaftet, weil sein letzter(?) Besuch dort in Verbindung mit dem Verschwinden seines Gastgebers Ammon Zichroni gebracht wird.
Ammon Zichroni wächst streng jüdisch erzogen in einer Welt auf, die ihm Sicherheiten gibt, wähnt er sich doch im Schoß der Familie und des Ewigen, mit dessen irdischen Vollstreckern es aber nicht immer leicht auszukommen ist. Weil er das falsche Buch las, schickt ihn sein Vater zum „Onkel“ in die USA. Dort studiert er, um sich schließlich als Analytiker in Zürich niederzulassen. Dann lernt er den Geigenbauer Minsky kennen. Ammon verfügt über die Begabung, die Erinnerung anderer Menschen fühlen und erleben zu können. Er animiert Minsky, sich den Schatten seiner Vergangenheit zu stellen, Schatten, deren Existenz plötzlich durch den Journalisten und Autor Jan Wechsler infrage gestellt werden.
Zwei Erzählstränge, zwei Menschen, zwei Lebensgeschichten, zwei Erinnerungen, die sich beißen und schneiden. Die Jan-Wechsler-Episode atmet Vergänglichkeit. Uhren sind ein Symbol dafür. Ebenso die fehlende Erinnerung. Bei Ammon Zichroni erstarrt alles im Glanz des Ewigen. Die Demantoide, jene Steine, mit denen sein „Onkel“ handelt, stehen für das Andauernde, das Beständige, am Ende für den Ewigen selbst, der sich in der Schönheit der Steine manifestiert.
Ich versuche, mich an die Hilflosigkeit zu erinnern, die der Roman bei mir auslöste, eine tiefe Verunsicherung, die sich nur in der Schönheit der Sätze fangen konnte.
„Und schließlich: Eine mechanische Uhr tickt. Sie schweigt nicht oder lässt lediglich das müde Schlappen eines quarzgesteuerten Schrittmotors vernehmen; nein, sie tickt. Jeder Sekundenbruchteil hinterlässt im Entschwinden einen Nachhall. Das sind pro Minute hunderte tickende Erinnerungen an die Tatsache, dass die Zeit zumindest für mich nicht unendlich ist, der ich meine Uhr immer wieder einmal ans Ohr halte, um dem so hörbar gewordenen Verrinnen der Zeit für eine Weile zu lauschen.“
Sätze wie dieser, die wie ein Demantoid sind, mit einem im Innersten gefangenen göttlichen Strahlen, müssten eigentlich jedes Leserherz zum Stillstand bringen. Ich meine, mich meines Begeisterungsschreis zu erinnern, der mich vom Sofa hochfahren ließ, um dem Autor eine fast kindlich anmutende Mail zu schreiben, in die ich meine Freude packte. Aber nur er wird bestätigen können, ob ich sie tatsächlich an ihn sandte.
„Die Leinwand“ ist ein fein und genau gearbeiteter Roman, und dies soll ihn nicht niedlich machen. Ein großer Roman, einer der wenigen Romane, die ich – da bin ich mir nahezu sicher – irgendwann noch einmal lesen werde. Das Vorrecht ereilte in meinem Fall bisher nur den „Zauberberg“, den „Doktor Faustus“ und „Lolita“. Dies sei nur angemerkt, damit wir wissen, von welcher Kategorie Roman ich hier schreibe.
Ich sitze in meinem Kopf-Kino und starre auf die Leinwand. Musik ertönt. Ein traurig schönes Lied. Vielleicht Klezmer. Ein Mann tritt auf. Er spricht über den Schabbes. Nicht telefonieren. Kein Auto fahren. Einfach nur spazieren gehen. Liegen. Eine Insel in der Zeit. Ich meine, mich zu erinnern, dies in Steins Roman gelesen zu haben. Ich bin mir nicht sicher. Sie müssen schon selbst nachlesen. Müssen überprüfen, woran ich mich die ganze Zeit über zu erinnern meine.
Wer sind Sie? Ich bin ein Autor, der hin und wieder seine Eindrücke von Büchern in einem Text hinterlässt. Texte bewahren auf. Sie sind ein Stück Erinnerungskultur. Aber wer schrieb, welche Absichten hatte der Schreiber? Wir sollten sehr vorsichtig mit dem sein, was wir Identität nennen. Oder aber wir lassen uns endlich auf das Spiel ein und erkennen: Wir alle sind Autoren, die andauernd und beständig ihren eigenen Lebenstext schreiben, verändern, verfälschen. Wir sind Literatur. Atmend, liebend, zeugend, hassend, rächend.
Guido Rohm
Benjamin Stein: Die Leinwand, C H Beck 2010
Weitere Besprechung zum Buch von Thomas Hummitzsch: www.textem.de/index.php